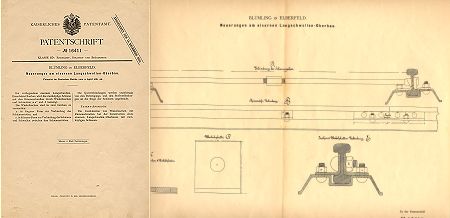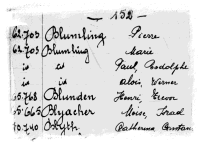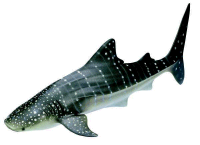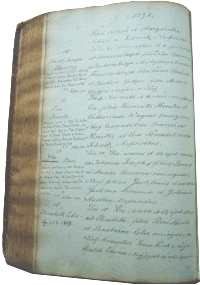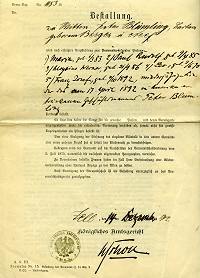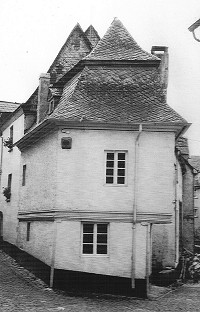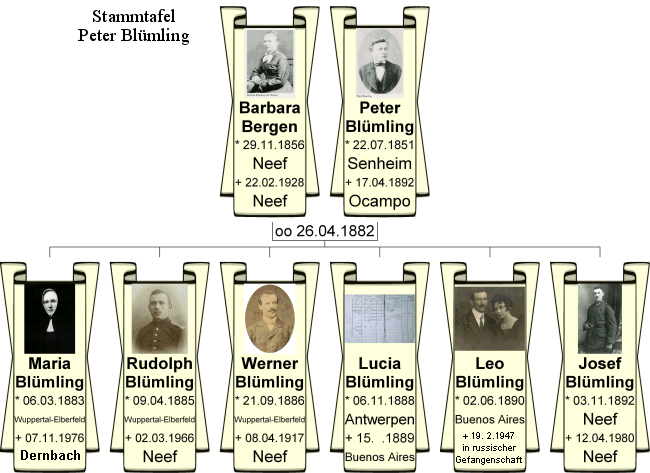Das Drama um eine
Auswanderung nach Argentinien |
von Franz
Josef Blümling |
 1. Das Neefer Bäbche
1. Das Neefer Bäbche
Barbara Bergen, liebevoll Bäbchen
genannt, wurde 1856 in Neef geboren. In
ihrem Elternhaus herrschte reges Leben.
Dort befand sich die größte Wirtschaft
von Neef. Sie lag in der Nachbarschaft
der Matthiaskirche. Neben dem
Gaststättenbetrieb, der auch
Übernachtungen anbot, wurden zudem noch
Weinberge bebaut und eine bescheidene
Landwirtschaft mit Viehzucht betrieben.
Die wirtschaftliche Situation im
Moselland war im Allgemeinen krisenhaft,
und es gab kaum eine Perspektive. Viele
Moselaner, oft waren es ganze Gruppen,
wanderten in ferne Länder aus. Eine
solche Auswanderungswelle berührte Neef
nicht. Es lag daran, dass von 1872 bis
1896 die Bahn von Koblenz nach Metz
gebaut wurde. Und die Neefer Trasse war
eine einzige Großbaustelle. Tunnel,
Brücke, Viadukte, sowie Über- und
Unterführungen mussten errichtet werden.
Jeder Bürger, der wollte und konnte,
fand Arbeit. Auch Bauarbeiter aus fernen
Gauen waren in Neef beschäftigt und
benötigten Quartier mit Beköstigung. So
hatte die Gaststätte der Eheleute Franz
Thomas und Annamaria Bergen regen
Zuspruch, und es gab keine finanziellen
Nöte im Elternhaus vom Bäbchen.
Neef war zuvor ein kleines
verschlafenes Winzerdorf, das nur über
einen holprigen Feldweg nach Bullay hin
die Verbindung zur Außenwelt hatte.
Nicht umsonst lag für die
Nachbargemeinden „Neef am Ende der
Welt“, oder auch dort, „wo die
Welt mit Brettern zugenagelt ist.“
Den Neefern störte eine solche
Einschätzung nicht. Neef war ein
Dörfchen für sich – war eine
große Familie.
Bäbchen war 15 Jahre alt, als
plötzlich ihre Mutter starb. Als
einziges Kind war sie nunmehr für ihren
Vater sowohl in der Gastwirtschaft als
auch im Haushalt eine große und
unverzichtbare Hilfe. Der alternde und
kränkelnde Vater hätte gerne einen
tüchtigen Schwiegersohn als Gastwirt in
seiner Schänke gehabt. Bäbchen lehnte
jedoch jeden Bewerber ab.
Barbara war hübsch, lustig und als
spätere Alleinerbin des elterlichen
Vermögens, was neben dem Haus auch viele
Weinberge und Gartenland ausmachten, auch
als reich zu betrachten. Ja, man sagte
ihr nach, dass sie das reichste Mädchen
im Ort wäre.
Doch dann kam ein studierter
Bahnmeister in die Wirtschaft und mietete
für einige Wochen ein Fremdenzimmer. Er
inspizierte die laufenden Arbeiten an der
Bahnstrecke in Neef. Er hieß Peter
Blümling, war 29 Jahre alt und
entstammte einer Familie aus Senheim
– war aber schon lange in der
Großstadt Elberfeld ansässig. Seine Art
war streng und konkret. Zu ihm, diesem
Weltmenschen, hatte Barbara von Anfang an
eine Zuneigung. Vater sah dies voller
Unwillen. „Warum willst du
Beamtenfrau werden? Warum schlägst du
die passenden Partien der tüchtigen,
braven, fleißigen Männer aus Neef aus?
Du wirst unglücklich werden, liebes Kind!
Zu einer Heirat mit diesem Fremden
bekommst du von mir nicht die
Einwilligung!“ Schließlich musterte
Pastor Rudich den Bahnmeister während
eines Gespräches in seinem Pfarrhaus.
Einen Tag später bat dann Hochwürden
das Bäbchen zu sich und teilte ihr in
aller Deutlichkeit mit, dass auch er den
Bewerber ablehne, da er gar nicht zu
ihrer natürlichen Frohnatur passe. Zudem
müsse sie doch bei einer Heirat ihr
vielgeliebtes Neef verlassen und in eine
Großstadt ziehen. Außerdem solle sie
auch auf den guten, alten und
kränkelnden Vater Rücksicht nehmen.
Nach einem weiteren Jahr starb der
Vater im Jahre 1881. Im April des
folgenden Jahres heirateten Peter und
Barbara. Der Einsegnungsspruch des
Pfarrers lautete: „Es möge die Ehe
ein Reich der Liebe und des Friedens
werden und bewahrt bleiben vor zu
schweren Schicksalsschlägen.“ Das
„Neefer Bäbchen“ zog nun mit
ihrem Peter nach Elberfeld.
|
| |
| |
| erschienen in |
| Jahrbuch des
Kreises Cochem-Zell, 2008 |
| |
| |
| |
| |
 |
| Barbara Bergen |
| |
| |
 |
| Peter Blümling |
|
| |
|
 2. Als Beamten-Familie in Elberfeld
2. Als Beamten-Familie in ElberfeldNicht
nur deshalb, weil Barbara noch nie von
Neef herausgekommen war, und sie
plötzlich in einer völlig fremden Welt
stand, begann nun ein Leidensweg, der nur
durch einen unerschütterlich festen
Glauben an Gott ertragen werden konnte.
Ihr Mann arbeitete tagsüber im Büro.
Sie war von der Menschheit isoliert, saß
oft weinend und allein in ihrer Wohnung.
Es gab kein Gespräch mit Freunden und
Bekannten. Oft ging sie in die Kirche,
stellte Kerzen auf und betete darum, dass
sie doch wieder fröhlich und zufrieden
werde. Sie fand in ihrem Seelenschmerz
kaum Verständnis von ihrem strengen Mann.
Immer mehr sehnte sie sich nach dem
frohen und lustigen Treiben in der Neefer
Gastwirtschaft und träumte nächtelang
von ihrer geliebten Heimat. Einmal fuhr
sie nach Neef. Alle wunderten sich, wie
sie es in der Großstadt aushalten konnte,
hatte sie doch bis zum 25. Lebensjahr
noch nie den Ort verlassen. Der Besuch in
Neef machte ihr das Herz noch schwerer.
Im März 1883 wurde dem Ehepaar dann
ein gesundes und kräftiges Mädchen
geschenkt, das auf den Namen Maria
getauft wurde. Zur Tauffeier kamen
Verwandte und Freunde von der Mosel, und
es wurde herzlich und fröhlich gefeiert.
Man tauschte alte Erinnerungen aus und
berichtete über Neuigkeiten aus Neef.
Als die Gäste wieder wegfuhren, ward
Barbaras Herz noch schwerer. Übergroßes
Heimweh überfiel sie.
Erst als in den Jahren 1885 und 1886
Rudolf und Werner auf die Welt kamen,
fand sie sich als Mutter von drei Kindern
in der Fremde besser zurecht. Die
quirligen und gesunden Kinder ließen sie
wieder froh werden. Ihr Mann hatte zwar
die Ernsthaftigkeit nicht verloren, aber
daran hatte sie sich gewöhnt.
Andererseits hatte Peter eine Erfindung
für die Bahn gemacht, die ihm patentiert
wurde und bei seinem Arbeitgeber zu hohem
Ansehen verholfen hatte. Barbara konnte
also auch stolz sein auf einen tüchtigen
Mann. Zudem ging Peter nun auch einmal im
Monat mit ihr in ein Konzert, was beiden
sehr gefiel.
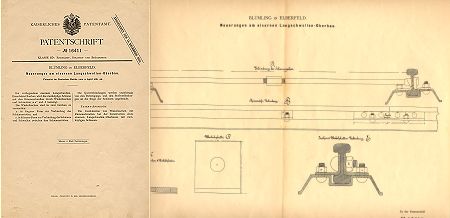
Patentschrift
|
 |
| Mit diesem
Zeugnis des Senheimer
Bürgermeisters wurde Peter in
den Dienst bei der Bahn
aufgenommen |
| |
| |
 |
| Das Schreiben
des Kaiserlichen Patentamtes vom
25. Juli 1881 |
|
| |
|
 3. Bergwerksbesitzer in Elberfeld
3. Bergwerksbesitzer in Elberfeld
und der finanzielle RuinDas
Beamtengehalt reichte gut aus, um ein
normales bürgerliches und abgesichertes
Leben zu führen. Das war aber Peter zu
wenig. Wie aus heiterem Himmel eröffnete
er seiner Frau: „Man hat mir ein
Angebot gemacht, was nicht zu verachten
ist. Ich kann ein Bergwerk kaufen. Dort
ist Metall gefunden worden. Für jemanden,
der Unternehmungsgeist hat, kann dies
eine Goldgrube werden. In einer Woche
kann ich so viel herausschlagen, wie ich
als Beamter in einem Vierteljahr verdiene!
Mit dem Vermögen, was Du in die Ehe
eingebracht hast, kann ich das Bergwerk
bar bezahlen“. Barbara war geschockt.
Sie hatte fest vor, von ihrer Mitgift ein
Haus zu kaufen, um dort mit der Familie
zu wohnen. Peter jedoch erkannte im
Erwerb des Bergwerkes die Chance seines
Lebens. Schließlich gab das Bäbchen
nach.
Peters wahrer Grund zu diesem
Unterfangen war es sicherlich gewesen,
mindestens genau so erfolgreich zu werden,
wie sein älterer Bruder Heinrich in
Essen als Kaufmann schon lange war.
21jährig gründete der
Klempnermeister Heinrich Blümling nach
Wanderjahren im In- und Ausland 1877 in
Essen an der Ruhr ein
Installationsgeschäft mit Kupferschmiede
und entwickelte voller Fleiß und
Weitblick bald ein ansehnliches
Unternehmen daraus. Von den kleinsten
Anfängen ausgehend, werden größere
Aufträge für die damaligen
Gesellschaften der Bergisch-Märkischen
und der Köln- Mindener Bahn, die Krupp-Werke,
den Bergbau und Siedlungen in Essen,
Bochum Köln und Frankfurt ausgeführt.
Gleichzeitig wird im Hause ein
Einzelhandelsgeschäft mit
Küchengeräten, sanitären Artikeln und
Beleuchtung betrieben, das sich im Laufe
der Jahre über drei Stockwerke ausdehnt.
Durch das ständige Anwachsen des
Betriebes wurde die Schaffung einer
geräumigen Werkstatt mit Lager
erforderlich. Die Firma Heinrich
Blümling war in der damaligen Zeit ein
bemerkenswerter Emporsteiger. Sein
Geschäftshaus prägte den zentralen
Vierhofer Platz in der Großstadt Essen.
Die Entwicklung des Unternehmens war
zu Anfang tatsächlich recht positiv.
Doch dann kam ein Rückschlag. Monatelang
arbeitete man ohne Erfolg. Dazu kam, dass
ein Mädchen, das zur Fabrik gehen wollte,
durch eine zu früh losgegangene
Sprengung so unglücklich zu Fall kam,
dass ihm ein Bein amputiert wurde. Für
alles musste Peter haften und dem
Mädchen sogar eine lebenslange
Unfallrente zusagen. Die Firma kam in
Zahlungsschwierigkeiten. Das Bergwerk
musste verkauft werden. Notgedrungen
geschah dies zu einem besonders niedrigen
Preis. Die Käufer waren clevere und
gerissene Geschäftsleute. Sie
investierten viel Geld in das Unternehmen,
das schon bald blühend da stand. Umsonst
bettelte der gedemütigte vormalige hohe
Beamte bei den Geschäftsleuten um eine
bescheidene finanzielle Unterstützung.
Peter hätte ohne Weiteres wieder in
seinen Beruf zurückkehren können. Er
tat es nicht, weil er sich wegen der
erlittenen Niederlage schämte. Barbara
hatte in Neef noch sechs Fuder Wein
liegen. Man ließ sie kommen. Vielleicht
war dies ein Grundstock, um ein
Weingeschäft zu gründen. Doch das
Schicksal wollte es einmal wieder anders!
Als das erste Fass in den Keller gerollt
wurde, kam es ans Rutschen und
zertrümmerte an der Wand. Der ganze
Inhalt ergoss sich in den Keller. Der
Verkauf der restlichen fünf Fuder
reichte gerade aus, um den erlittenen
Schaden zu ersetzen.
Die Not wurde immer größer. Alles,
was einen Wert besaß und man nicht
unbedingt benötigte, wurde verkauft. Die
Familie stand vor dem Nichts! Und Peter
wollte weiterhin nicht mehr Bahnbeamter
werden. Nun eröffnete er seiner Frau,
dass er auswandern wolle und zwar nach
Argentinien. „Dorthin wandern viele
aus. Nicht wenige wurden dort schon bald
reich. Warum nicht wir auch? Schließlich
bin ich der spanischen Sprache mächtig,
das muss sich doch als Vorteil auswirken!“
Abwarten wollte er noch, bis das vierte
Kind geboren sei. Barbara war entsetzt.
Peter duldete in seiner strengen Art
keine Widerrede. Er zeigte sich,
zumindest nach Außen hin, als einen
starken und gefestigten Mann.
Andererseits hat er jedoch in einem
unbeobachteten Moment in seiner Wohnung
herzzerreißend geweint. Er machte nun
ganz alleine eine Wallfahrt nach Kevelaer
und suchte für sein Unterfangen Gottes
Beistand und die Fürbitte von der
Gottesmutter. Ohne Risiko war das
Vorhaben nicht! Das wusste er!
Hoffnung hatte nun ein Professor
gemacht. Er war als Deutscher Techniker
im argentinischen Staatsdienst tätig und
unter anderem auch mit dem Aufbau der
dortigen Bahn beauftragt. Vater hatte ihn
allerdings recht flüchtig kennen gelernt.
Jedoch hatte dieser Mann konkret zugesagt,
Vater bei der Ankunft des Schiffes zu
empfangen und ihm umgehend eine Stelle im
Staatsdienst zu besorgen.
|
 |
| Das
Geschäftshaus Viehofer Platz 1
in Essen |
| |
| |
|
| |
|
 4. Mit einem Auswanderer-Schiff nach
Buenos Aires
4. Mit einem Auswanderer-Schiff nach
Buenos AiresLucia, das vierte Kind,
war ein überaus hübsches, liebes Kind.
Werner war drei Jahre, Rudolf vier Jahre
und Maria 5 ½ Jahre alt. Nur noch 200
Mark blieben zur Bestreitung der
Reisekosten und um im fremden Land eine
Existenz anzufangen.
In Antwerpen konnte das bestimmte
Schiff nicht bestiegen werden. Maria
hatte Scharlach. Sie musste sechs Wochen
im Krankenhaus verweilen. Zudem bekamen
Rudolf und Werner Keuchhusten. Etwa zwei
Monate wohnte man in einer sehr
bescheidenen Unterkunft in äußerst
ärmlichen Verhältnissen.
Endlich waren alle wohlauf und die
Überfahrt nach Argentinien konnte am 2.
Februar 1889 beginnen. Der Fahrpreis
wurde durch die holländische Regierung
bezahlt und war in 2 ½ Jahre
zurückzuzahlen. Er betrug je Person 155
½ Francs. Die Auswanderer bestanden
hauptsächlich aus Landwirten und
Handwerksleuten und waren Deutsche,
Luxemburger, Franzosen, Wallonen und
Flamen. Paketstücke wurden fast
unbeschränkt angenommen. So waren viele
voll bepackt mit Handwerkszeug,
Hausgeräten, Wäsche und Sonstigem. Es
handelte sich zumeist um ganze
Familiencliquen.

Auswanderungsschiff
Ausschnitte aus dem Tagebuch des Peter
Blümling:
| 2.2. |
Passagiere
gehen an Bord des Dampfschiffes
„Hannover“ von der
Bremer Lloyd - viele Zuschauer -
Abreise am Mittag um 1 ½ Uhr
– unfreundliches Wetter
– Wasser recht unruhig
– nachts viele Seekranke
– überall stöhnen –
gurgeln – brechen –
klagen und jammern –
erkennen den französischen Hafen
Dünkirchen – später den
englischen Hafen Dover |
| 3.2.
|
Sturm
– Böen schlagen oft über
Deck – insbesondere Frauen
und Kinder seekrank –
überall schwankende Gestalten
– klägliches Bild –
viele alte Leute – weshalb
für diese noch so ein lange
Reise? |
| 4.2. |
verlassen
den Kanal – sind im Golf von
Biscaya - See noch unruhiger
– Kisten und Kasten fliegen
umher – man kann kaum im
Bett liegen – Seekrankheit
ganz schlimm – heute kein
Land und kein Schiff gesehen |
| 5.2. |
im
spanischen Hafen Coruna noch
Passagiere aufgenommen –
zudem mit 20 lebenden
Schlachtochsen, Kohle, Wasser und
mit sonstigem Proviant eingedeckt
– spanische Händler an Deck
- verkaufen Obst |
| 6.2. |
Abfahrt
aus Coruna – nach 6 Stunden
legen wir in Villa Gratia an
– ein herrliches Städtchen
- spanische Auswanderer
aufgenommen – Wein und
Cognac werden angeboten zu 1
Franc jé Flasche – auch
Obst zu kaufen – am gleichen
Tag wieder Abfahrt |
| 7.2. |
erreichen
die Stadt Vigo an der
portugiesisch/spanischen Grenze
– wieder Aufnahme von
Passagieren – nunmehr fast
1300 Personen an Bord – alle
mussten mit ihren Lagerstätten
zusammenrücken –
Südländer erhielten
zusätzliche Kost – war
stark gewürzt – kostete
mehr – die
„Braungesichter“ waren
sehr ungeniert – Vigo
malerisch schön – sahen
erstmals Weinberge – Abfahrt
um 11 ½ Uhr –
Schweinefische tauchen auf –
viele Seemöwen begleiten uns
– feuchtes und mildes Wetter
– Festland verschwindet
– allgemeine Gesundheit an
Bord – es gab Heringe gegen
die Seekrankheit zu essen –
dazu Reissuppe und auch
Erbsensuppe |
| 8.2. |
windig
mit Regen – Wasser ist knapp
– auf Deck steht ein Kübel
mit Trinkwasser – jeder
bekommt 1/8 Ltr. – musste
direkt getrunken werden –
alle trinken aus einem Becher -
an einem Strick befestigt –
kein Wasser darf mitgenommen
werden – auch nicht für
kleine Kinder – ist lt. III.
Steuermann nicht anders möglich
– „bei
Änderungswünschen bitte an den
Herrgott wenden“ -
Trinkwasserversorgung ist ein
Problem - Weshalb so wenig Vorrat? |
| 9.2. |
südliches
Klima recht deutlich fühlbar
– können ohne Decke
schlafen – von nun an
erhalten wir täglich mittags
Rotwein |
| 10.2. |
zu
drei Mahlzeiten wird mit Schelle
aufgerufen – Essen holt sich
jeder selbst gegen Vorlage einer
Blechmarke – oft großes
Gedränge – vielen schmeckt
das Essen nicht –
Beschwerdebrief mit vielen
Unterschriften ging an den
Kapitän – für mich ist das
Essen recht gut - appetitliche
Suppen mit Fleisch – in der
Nacht Madeira passiert –
Leuchtturm sichtbar |
| 11.2. |
kein
Schiff gesehen – Insel Las
Palmas in Sicht – Häuser
gut erkennbar |
| 12.2. |
in
der Nacht Kind wallonischer
Eltern gestorben und in das Meer
versenkt – war bereits des
zweite Kind, das auf der Reise
starb – viele der neu
hinzugekommenen Spanier seekrank
– Rudolf etwas leidend
– isst wenig -
Gesundheitszustand ansonsten
allgemein recht gut – am
Mittag ein Schiff sichtbar –
fährt nach Europa - es wird viel
auf Reinlichkeit gehalten -
laufend wird gekehrt und Sand
gestreut – nachts wird
geschrubbt |
| 13.2. |
weder
Schiff noch Insel gesehen –
eine Anzahl der Kinder krank ohne
einheitliche Ursache –
Seekrankheit allgemein
überstanden – Barbara den
ganzen Tag im Bett – ist
sehr schwach und ohne Appetit
– Arzt gab ihr Rizinusöl
– schwächte sie noch mehr
ab – musste andauernd
abführen – Luxemburger
Musikanten spielen mit Harmonika,
Horn und Trommeln – getanzt
und gesungen wird kaum –
dagegen viel Karten gespielt
– die anständigsten
scheinen die Deutschen zu sein
– die Wallonen sind stets am
hetzen – Spanier sind faul
– gehen früh schlafen und
stehen spät auf – tagsüber
liegen sie ausgestreckt auf dem
Deck- sind ansonsten die
hübschesten Leute –
namentlich die Frauen tragen
schöne Kleider - haben gutes
Aussehen und aufrechte Haltung
– singen jedoch wenig –
haben auch schlechte Stimmen
– es wird zu ¾ französisch
gesprochen |
| 14.2. |
um
3 Uhr nachmittags Insel St.
Vicennes (Sao Vincente -
Kapverdische Insel) in Sicht
– hat die Form eines
schlafenden Riesen - kahle
unfruchtbare Felsenwildnis –
rußbraunes Aussehen - ankern
dort und laden Kohle –
Hauptkohlestation für Schiffe,
die zwischen Europa und
Südamerika fahren – Dampfer
und Segelschiffe ankern –
delikate Orangen gekauft –
20 Prachtexemplare kosten 1 Franc
– Kokosnüsse das Stück 30
Centimes - Bevölkerung besteht
aus kastanienbraunen Negern
– viele Perlen- und
Korallenfischer mit kleinen
Nachen auf dem Wasser –
tauchen bis auf den Grund unter
Wasser – teils mit 4-spitzigen
oder ähnlichen Gabeln
ausgerüstet |
| 15.2. |
Abfahrt
von St. Vincennes |
| 16.2. |
am
Morgen um 7 Uhr ein nach Europa
fahrendes Schiff und einen
Schoner gesehen - Preise an Deck:
1 Pfund Seife 1Franc, 200 gr.
Tabak 1 Fr., 1 Fl. Bier 1 Fr., 1
Dose Sardinen 1 Fr., 1 Fl. Rum 2,50
Fr., 1 Fl. Genever 2 Fr., 1 Fl.
Pfefferminze 2,10 Fr., 1 Fl.
Appollinaris 0,75 Fr., ½ Fl.
Kaiserbrunnen 0,50 Fr. |
| 17.2. |
Hitze
sehr empfindlich – viele
Kinder krank – ein 32jähriger
Mann mittags vom Sonnenstich
getroffen – erholte sich
jedoch wieder – fast alle
Passagiere schlafen nunmehr
nachts auf dem Deck – man
liegt auf Seilen, Fässern,
Bänken, quer auf dem Fußboden
und in Hängematten - Schiff ist
überbesetzt – jede Ecke ist
mit Betten eingerichtet - sogar
dicht bei der Maschine –
auch neben der Küche, wo der
Küchendunst direkt auf die
Betten zieht – im
Zwischendeck fehlt die
Ventilation - Geschäftemacherei
mit armen Leuten! –
ärztliche Pflege sehr mangelhaft
– 18jähriger Arzt ist
gleichzeitig Apotheker –
besitzt drei Medizinen –
damit werden alle Krankheiten
behandelt – es gibt nur
wenige kleine Zimmer für Kranke
– ohne Ventilation -
Eingangstür steht deshalb immer
offen – Ansteckungsgefahr
groß – Deck ist mit
Schutzdächern überspannt –
sieht heiter aus – man liegt,
sitzt, steht, geht, kartet, tanzt,
singt, schimpft, wäscht etc.
– wie auf einem Jahrmarkt
– verschiedene Hüte und
Mützen - halbnackte Männer und
Frauen - ganz nackte Kinder -
halbkranke und sehr kranke –
alle suchen schattige und luftige
Plätze – auf Deck kaum ein
Durchkommen |
| 18.2. |
Schiffskoch,
starker junger Mann, Vater von
zwei Kindern, am Hitzschlag
gestorben – für das
Mittagessen noch gekocht –
am Nachmittag tot – viel
Aufregung gehabt – ein
Wallone prügelte seine Frau
– meine Bettnachbarn, zwei
Spanier, verkloppten sich –
ein Flame wollte Küchengehilfe
erstechen – beschädigte ihn
aber nur an der Hand –
Schiffsglocke läutete zur
Bestattung des Kochs –
Leiche auf ein Brett gelegt, mit
Tuch überspannt und beschwert -
ins Wasser gelassen –
gesamte Schiffsbesatzung folgte
der Leiche, die schnell im Meer
unterging |
| 19.2. |
Äquator
durchfahren - Hitze sehr groß
– Trinkwasser warm und
schlecht – viele haben
Leibweh – Milch nur für
Kleinkinder: je ¼ morgens und
nachmittags – ältere Kinder
erhalten Erwachsenenkost –
chaotische Verhältnisse auf dem
Deck – keinen Augenblick
Ruhe – Kinder schreien um
Wasser - Kranke klagen –
Streit um bessere Plätze -
hadert miteinander - schimpft
über schlechte Einrichtung des
Schiffes und über die Hitze
– Unzufriedenheit wird immer
größer – wenigen geht es
allerdings gut und werden dick
– wünschen, noch lange
nicht an Land zu kommen, um noch
viele Tage mühelos beköstigt zu
werden |
| 20.2. |
kleiner
Flame zur Welt gekommen –
Mutter und Kind wohlauf –
von unseren Kindern geht es
besonders Lucie schlecht –
Maria hat viel Husten – alle
Kinder haben Ausschlag - viele
husten – Wäsche wird
besonders bei den Mannspersonen
wenig getragen – tragen
meist nur einen Kittel oder eine
Jacke auf bloßer Haut – die
beste Wäsche haben die Deutschen
und die Spanier – haben
zumeist bunte, gute Kopfbedeckung
und gute Schuhe –
Oberkleider sind oft zerflickt
– Frauen kommen durchaus
reinlich – sehr bunt und
schamhaft gekleidet – man
sieht allerdings nie eine ohne
verdeckte Brust, wenn sie ihre
Kinder säugen |
| 21.2. |
am
Vormittag hat sich der
Kajütensteward erschossen –
wurde nachts bei dem
Dienstmädchen einer Passagier-Herrschaft
in der Kajüte angetroffen –
als Strafe sollte er die Aborte
reinigen – fühlte sich in
seiner Ehre gekränkt – ein
Mann vom Hitzschlag getroffen
– erholte sich jedoch wieder
– am Abend ein Schiff in
Sicht, am Signallicht erkannt |
| 22.2. |
Segelschiff
und eine nach Europa fahrende
Barke gesehen – Kinder
erhalten nun zusätzlich
Haferschleim – höchste Zeit!
kleinere Kinder alle sehr
abgemagert – Milch ist zu
knapp - Küchenkost nehmen sie
nicht an – heute sechs
Kinder gestorben – zumeist
an Ruhr – waren voll mit
Ausschlag, der schwach eiterte
– es folgte schnelles
Abführen mit Blut vermischt,
Entkräftung und dann schnelles
Absterben – Hauptursache ist
das schlechte Wasser, aber auch
die Nachlässigkeit der Eltern
– liegen oft neben ihren
schwerkranken Kindern und trinken
Wein – eine wirklich tiefe
Stufe menschlichen Standpunktes! |
| 23.2. |
heute
Nacht kleiner Wallone geboren
– Mutter und Kind sind
gesund – morgens um 5 Uhr
brasilianische Küste in Sicht
– um 10 Uhr Dorf zu erkennen
– um 11 Uhr Einfahrt in den
Hafen Baia – 25 bis 30
Schiffe ankern – auch ein
Hamburger Dampfer - wunderschöne
Stadt – Häuser sind
einstöckig, weiß, rot und grün
angestrichen – viele Kirchen
- überall Palmen - fast nur
Neger zu sehen – ca. 1 ½ m
große Schnabelfische und eine
Menge fliegender Fische im Wasser
– Wasser getankt - Streit an
Deck zwischen Flamen und
Luxemburgern – mehrere
Leichtverletzte – fünf Mann
ca. 1 ½ Stunden mit
geschlossenen Händen auf der
Brücke gefesselt –
Luciechen magert sehr ab – 5
Uhr am späten Nachmittag Abfahrt
von Baia |
| 24.2. |
Lucie
sehr leidend – verweigert
jegliche Nahrung, auch die
Hafergrütze – wende mich an
den Kommissaren – konnte
nicht helfen – wende mich an
den Doktor – verschrieb eine
Tasse Bouillon mit Ei – auch
keine Aufnahme von Lucie –
Kapitän schaltete sich ein
– kann nicht helfen, da die
Menschenmenge zu groß sei –
„kann auf Einzelwünsche
nicht eingehen“ – Menge
der Nahrung sei genügend -
Kapitän scheint unsauberen
Charakters zu sein |
| 25.2. |
verschiedene
Schiffe in Sicht – auch
eines von der Norddeutschen Lloyd
– brasilianische Küste
wieder gesehen – zwei Flamen-Frauen
blutig gerauft – wurden
arrestiert (verhaftet) und auf
die Kommandobrücke geführt,
jedoch bald wieder gehen gelassen
– Flamenkind in der Nacht
gestorben – Mutter hatte
wenig Trauer und sagte, dass sie
ja noch drei Kinder hätte –
viel Unsauberkeit unter den
Leuten – Köpfe voller
Schmutz – Kinderwäsche wird
in Essgeschirren gewaschen –
nachts wird auf Deck der Auswurf
unter sich gehen lassen –
beim Kehren ekelhafter Gestank
– wieder Beschwerden wegen
schlechter Küche von Seiten der
Wallonen an den Kapitän
gerichtet - Franzosen sind
ständig unzufrieden und
verkaufen sozialistische
Zeitschriften – starkes
Wetterleuchten in der Nacht |
| 26.2. |
zwei
Schiffe gesehen – Lucie geht
es etwas besser –
Trinkwasser jetzt reichlich
vorhanden – wird sogar zum
Waschen gebraucht – ist auch
notwendig, da Seewasser schlecht
wäscht – jeden Morgen wird
Wein verabreicht, der von vielen
auf einmal getrunken und nicht
vertragen wird – erzeugt
viele Zänkereien |
| 27.2. |
schäumende
Wellen leuchten in der Nacht
– glühen in Millionen
leuchtender Funken – eine
Folge des warmen Salzwassers
– Himmel in der Nacht heller
als zu Hause – Blitze sind
kolossaler – Wolken massig
und schwarz - hängen viel tiefer
als in Europa |
| 28.2. |
Wallonen
und Luxemburger beschweren sich
über die Nahrung – ich
unterschreibe ein Attest wonach
die Nahrung für Erwachsene gut
ist – viele
Seeschwalben– Festland naht! |
| 1.3. |
massenweise
Seeschwalben und Schiffe zu sehen
– Seewasser nicht mehr so
blau –– es wird Zeit,
dass die Reise zu Ende geht
– immer mehr Unruhen auf dem
Schiff |
| 2.3. |
Ankunft
in Buenos Aires – sind in
großer Besorgnis – Lucia
stark abgemagert - musste sofort
in ein Krankenhaus, wo sie schon
bald starb – schon am
Sterbetag beerdigt - wegen der
großen Hitze dort so üblich |

Das Tagebuch des Peter Blümling
Hier endet nun das Tagebuch des Pedro,
wie Peter nun genannt wurde. Er fand für
weitere Aufzeichnungen nicht mehr die
Zeit und wohl auch nicht mehr die Muße.
Das Ableben der kleinen Lucia hatte sein
Herz gebrochen.
Hinzu kam auch noch die Enttäuschung,
dass der Professor, der Vater eine
Anstellung besorgen wollte, nicht
angetroffen wurde. Wie sollte dies auch
geschehen? Durch die Krankheiten der
Kinder wurde ja die Abreise in Antwerpen
von Woche zu Woche verschoben. Wäre die
Ankunft in Argentinien planmäßig
erfolgt, hätte man sich sicherlich
getroffen. Das Schicksal wollte es anders!
|
 |
Vor der Abfahrt
Copyright: Deutsches
Auswandererhaus / Foto: Werner
Huthmacher |
| |
| |
 |
Was wird die
Zukunft bringen?
Foto aus "Auf dem Weg nach
Amerika, Auswanderung im 17. und
18. Jahrhundert" mit
Genehmigung des Autoren Rolf
Böttcher |
| |
| |
 |
Großes
Gedränge bei der Essensausgabe
Foto aus "Auf dem Weg nach
Amerika, Auswanderung im 17. und
18. Jahrhundert" mit
Genehmigung des Autoren Rolf
Böttcher |
| |
| |
 |
Immer wieder
fand eine Beerdigung nach den
gegebenen Umständen statt
Foto aus "Auf dem Weg nach
Amerika, Auswanderung im 17. und
18. Jahrhundert" mit
Genehmigung des Autoren Rolf
Böttcher |
| |
| |
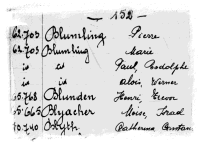 |
| Auszug aus dem
Bordbuch der "Hannover"
- Recherche über das
STADSARCHIEF Antwerpen von
Manfred Zimmer |
| |
| |
 |
| Das Schiff
machte am 5. Februar auf der
Hinfahrt Station in La Coruna.
Hier ist die Festung zu sehen. |
|
| |
|
 5.
Aufenthalt in Buenos Aires 5.
Aufenthalt in Buenos AiresDas
weitere Geschehen um die Auswanderung
wurde von nun an von der Tochter Maria
überliefert und zwar in der Zeit, als
sie Nonne im Kloster der Armen
Dienstmägde in Dernbach / Westerwald war.
Eingeflossen sind auch Auswertungen und
Schlüsse aus Dokumenten und vorliegenden
Briefen von der Verwandtschaft in Neef
und Senheim. Zudem wurden auch
Geschehnisse eingebracht, die Neefer
Bürger von ihren Altforderungen her noch
wussten.
Nicht zuletzt konnten auch
Einzelheiten aus Gesprächen, die der
Autor der Saga mit Maria Blümling und
seinem Vater Josef Blümling geführt hat,
eingebracht werden.
Die bescheidenen finanziellen Mittel,
die man zur Auswanderung zusammen gerafft
hatte, waren so gut wie aufgebraucht. Bei
einer Auskunftsstelle am Strand von
Buenos Aires erfuhr Senor Pedro, wie man
Vater nun nannte, dass man in einem so
genannten Emigrantenhaus für einige
Wochen unentgeltlich Wohnung und
Beköstigung haben kann. Es war ein
großes Gebäude – nicht sehr weit
vom Atlantischen Ozean entfernt. So
pilgerte die Familie mit Sack und Pack
dort hin. Man fand alles in etwa so vor,
wie man es auf dem Schiff in der 3.
Klasse erlebt hatte, nur waren die Betten
nicht übereinander, sondern standen in
großen Sälen nebeneinander. Das Essen
bestand aus Hülsenfrüchte-Suppen mit
reichlich Fleisch. Morgens und abends gab
es Kaffee mit Zwieback so viel man wollte.
Die Aborte waren immer sauber geschrubbt.
Jedoch gab es noch mehr Ratten und Mäuse
als auf dem Schiff. Auch musste man
dafür sorgen, dass Wanzen, Flöhe und
Läuse einen möglichst verschonten, was
nicht leicht zu erreichen war. Allerhand
Volk war zusammengepfercht – am
Boden sitzend oder liegend. Vielerlei
Sprachen waren herauszuhören. Sehr lange
dauerte der Aufenthalt in diesem Hause
nicht.
Mutter schrieb in dieser Not einen
eiligen Brief zu Vaters Verwandtschaft in
Senheim. Sie bat flehentlich um
finanzielle Unterstützung. Die Antwort
wurde recht schnell in einem Brief
gegeben, der am 7. Nov. 1889 in Senhals
abgestempelt war. Er war als "Poste
restante" (postlagernd) auf dem
Hauptpostamt in Buenos-Aires hinterlegt
und beinhaltete in kurzen und klaren
Worten, dass eine finanzielle Hilfe
überhaupt nicht in Frage kommt.
Vater fand außerhalb der Stadt Buenos
Aires eine Wohnung für einstweilen, bis
er, wie er hoffte, etwas Geeigneteres
gefunden habe. Das Haus lag in einer sehr
gepflegten Wohngegend und hatte einen
großen Hof mit einem Ziehbrunnen. Rundum
waren sechs große Zimmer, die von
älteren spanischen Familien bewohnt
waren. In eines dieser Zimmer zogen wir
ein. Schöne Straßen, an denen gepflegte
Villen standen, führten auf die
Hauptstadt Santa Fee zu.
Nach einigen Wochen kam der kleine Leo
zur Welt. Er wurde von
Redemtoristenpatern getauft. In dem
Kloster der Patres wohnten viele Deutsche.
Alle hatten viel Mitleid mit unserer
Familie. Sie machten uns Mut und gaben
den Rat, auf Gott zu vertrauen.
Jeden Tag ging Vater auf die Suche
nach einem geeigneten Wirkungskreis, doch
immer kam der arme Mann ohne Resultat
zurück. Mutter hatte viel Mühe, bei ihm
den Mut hochzuhalten. Handwerker, Bauern,
Gastwirte und Fuhrunternehmer wurden
gesucht, jedoch keine deutschen
Bahnbeamten.
Die Situation wurde immer schwieriger,
zumal plötzlich Bürgerkrieg ausbrach.
Was nun? Die Geldmittel gingen zu Ende.
In Buenos Aires gab es offenbar keine
Verdienstmöglichkeit für Vater. Er sah
eine solche eher im benachbarten Staat
Brasilien und reiste dort hin. Er blieb
lange weg. Für den Säugling konnte
Mutter noch jeden Tag einen halben Liter
Milch und für die größeren Kinder Brot
bezahlen. Nur selten gab es etwas Warmes
zu essen. Als Mutter in einem Koffer noch
von der Weihnachtsfeier in Elberfeld
stammende Nüsse fand, wurden diese unter
uns allen gleichmäßig verteilt und mit
Andacht verzehrt. Ein großes Heimweh
trat auf. Mutter hatte feuchte Augen.
Ich hatte nun eine besonderes Erlebnis,
was mich mein gesamtes späteres Leben
begleitete und auch beeinflusste: Ich sah
auf einer großen Wiese eine hohe Leiter,
die bis zum Himmel reichte. Ganz deutlich
zeigte sich die unterste Sprosse. Ich
lief zur Mutter und erzählte ihr, dass
ich zum Himmel hinaufsteigen wolle um
Brot und Kleider zu besorgen. Mutter
lachte und ging mit mir hinaus. Keine
Leiter war zu sehen. „Da hat mein
Kind wohl eine Halluzination gehabt“
– dachte meine Mutter. Ich jedoch
erkannte, dass wir in unserem Vorhaben
„Auswanderung“ erst die erste
Stufe einer großen Leiter bewältigt
hatten und dass noch viele Stufen zu
ersteigen sind. Das wollte mir Gott so
zeigen!
Es waren schon Wochen vergangen, seit
sich Vater von der Familie verabschiedet
hatte. Mutter wurde unruhig. So packte
sie eines Tages ihre vier Kinder und ging
ohne Sprachkenntnisse durch die Straßen
von Santa Fee, was wegen des
Bürgerkrieges sehr gefährlich war.
Überall stellte Sie Nachforschungen an
und erkundigte sich nach Vaters Verbleib.
Nach vergeblichen Bemühungen, sich in
einigen Büros verständlich zu machen,
fand sie endlich in einer Ministration
einen Dolmetscher, der bereit war, ihr zu
helfen.
Todmüde kamen wir in unserer Wohnung
an. Aus Mitleid brachte uns eine Köchin,
die in einer Nachbarvilla beschäftigt
war, etwas Essen, was fortan öfters
geschah. Dieses Almosen nahmen wir mit
schwerem, aber doch dankbarem Herzen,
gerne an und mag uns vor dem Hungertode
gewahrt haben.
Endlich kam Vater zurück. Die Freude
war riesengroß. Aber Mutter bemerkte an
seinem Äußeren und an seinem Benehmen,
dass er nichts erreicht hatte, wie dem
auch so war. Eine Möglichkeit nur sei
ihm geboten worden, nämlich eine Farm zu
übernehmen. Dieses Angebot hatte er
angenommen. Eine ungeheure Fläche sei
nun sein eigen. Zum Urbarmachen würden
eine Anzahl von Ochsen unentgeltlich
gestellt, aber sonst keine Hilfskräfte.
Eine Wohnung gäbe es dort und einen
Ziehbrunnen. Vor Jahrzehnten seien Polen
dort gewesen, die aber das Land verlassen
hätten und wieder in ihre Heimat
zurückgekehrt seien. „Es war nichts
anderes zu finden“ sagte er nicht
gerade mit Euphorie.
|
 |
Im „Totonda
de Retiro“, im
Emigrantenhaus, gab es für die
Einwanderer eine ärztliche
Betreuung und ein Arbeitsamt.
Seit dem Jahre 1906 wurden die
hinzugekommenen Einwanderer im
neuerbauten „ Hotel de
Immigrantes “ untergebracht.
Heute wird das Gebäude als
nationales Einwanderungsmuseum
genutzt.
Fotos aus dem Informationsbericht
über die Reise nach Argentinien
von Franz Appel (Sign. A. III 7 (2)
genehmigt von der Handelskammer
Bremen. |
| |
| |
 |
| Regierungsgebäude
von Buenos Aires zu jener Zeit
Fotos aus dem Informationsbericht
über die Reise nach Argentinien
von Franz Appel (Sign. A. III 7 (2)
genehmigt von der Handelskammer
Bremen. |
| |
| |
|
| |
|
 6.
Mit einem Ochsenkarren durch die Wildnis 6.
Mit einem Ochsenkarren durch die WildnisNach
zwei Tagen kam ein Karren mit Segeldach.
Zwei Ochsen waren vorgespannt. Ein
Indianer, der die Unbilden der Landschaft
kannte, saß auf einem Bock. Vater hatte
als Proviant schwarzen Tee und viel
Zwieback gekauft. Wir luden unsere
bescheidenen Habseligkeiten auf, wozu vor
allem Hausgeräte, Kleider und Betten
gehörten. Alles ging in lautloser Stille
vor sich. Eine Freude wollte auch bei uns
Kindern nicht aufkommen.
Ganze vier Wochen karrten wir durch
Steppen, Sümpfe und Urwälder. Krokodile
und zischende Schlangen waren keine
seltene Gefahren. An Sümpfen mit
quakenden Fröschen und viel
Dornengestrüpp kamen wir vorbei. Auch
hörten wir oft die Wilden aus dem Urwald
brüllen. Der Indianer gab dann aus
seinem Gewehr einen Schuss ab und das
Gebrülle verstummte für einige Zeit.
Raubvögel, die nach Opfern für ihre
Nahrung suchten und Moskitoschwärme
begleiteten unser Gefährt stetig. Als
wir einmal in einer verlassenen
Lehmhütte übernachteten, stand dort
eine Futterkrippe. Da legte Mutter den
kleinen Leo hinein und meinte schmunzelnd,
dass er nun wie das kleine Jesuskind
gebettet wäre.
Wenn nun unser Indianer Hunger hatte,
schoss er ein Feldhuhn, das er entfederte
und sofort roh verspeiste. Auch Vater
schoss Feldhühner, die Mutter am Feuer
gebraten hat. Das Holz für das Feuer
sammelten wir Kinder – mussten
jedoch stetig aufpassen, dass uns keine
Schlange in die Quere kam. Einmal schlug
Mutter eine solche mit der Axt in Stücke,
die nach dem Bruder Rudolf ausholte.
Endlich kamen wir in einer Gegend an,
wo es bestellte Felder gab. Einmal sahen
wir ein Rübenfeld, ein andermal eine
Grasfläche auf denen sich ein Schwarm
Heuschrecken niedergelassen hatte. In
zwei bis drei Minuten war alles
abgefressen, und der Schwarm zog weiter.
Die Felder waren in wenigen Minuten zur
kahlen Wüste geworden.
Als wir an Mais- und Zuckerrohrfeldern
vorbei fuhren, machten wir Halt. Ein
kleiner Mundraub sollte uns gestattet
sein und brachte etwas Abwechslung in den
Speiseplan. Die Maiskörner sättigten,
und die Zuckerrohrstangen wurden als
Nachtisch gekaut.
Wir wussten, dass eine bäuerliche
Ansiedlung in der Nähe sein musste. Und
tatsächlich kamen wir dann an einem
bewohnten und recht ordentlichen Hause an.
Seitlich vom Haus war ein See mit viel
Schilfrohr, Seerosen und Passionsblumen.
Wir gingen in das Haus hinein, wo eine
Frau an einem eisernen Kessel, der über
einem offenen Feuer hing, stand. Sie war
sehr freundlich und reichte uns einen
Maisbrei mit Fleisch. Es war das erste
ordentliche Essen nach vier Wochen. Wir
verschlangen es mit wahrem Heißhunger.
Die Nacht über rasteten wir auf der Erde
im Umfeld des Hauses. Vermutlich war es
die Aufgabe der so hilfsbereiten Frau,
Durchfahrende zu versorgen. Große
Entlohnung für ihre Dienste konnten wir
nicht bieten, was sie offenbar auch nicht
erwartete.
Am nächsten Tag ging’s weiter.
Immer öfter sahen wir nun verlassene
Lehmhütten. Daraus war zu schließen,
dass es ihre vormaligen Bewohner hier
nicht aushielten. Aus den Hütten kamen
oft Eulen geflogen, die durch das
Gerumpel des Ochsenwagens aufgeschreckt
wurden.
Bevor wir unseren Bestimmungsort
erreichten, sahen wir am frühen Morgen,
als es noch dämmerte, einen auffallend
großen Stern am Himmel. Mutter meinte,
da sei ein gutes Zeichen Gottes:
„Hier gehört ihr hin!“ Konnte
es so gedeutet werden? Sollten wir auf
der Himmelsleiter schon eine weitere
Sprosse erklommen haben? Und tatsächlich,
schon bald hielt der Indianer an und
sagte in seiner Landessprache: “Hier
laden wir ab. Hier das Land mit der
Hütte heißt Vaseil. Das gehört nun
euch“. Es gab keinen Vertrag, kein
Schriftstück, keinen Katasterauszug und
selbstverständlich auch keine
Grenzsteine zur Orientierung.
Vater half beim Abladen. Dann machte
der Indianer kehrt. Zuvor zeigte er noch
in eine Richtung und gab zu verstehen,
dass dort ein reicher Farmer wohne, bei
dem sich Vater beraten lassen könne. Und
in der anderen Richtung, etwa eine Stunde
entfernt, sei ein stehendes Gewässer am
Rande des Urwaldes.
Das war also das uns zugeteilte Land.
Es war riesig groß. Vater meinte, es
hätte ein Ausmaß von fast 100 Hektar.
Und diese Urwaldfläche sollte er, der
deutsche Bahnbeamte mit vier kleinen
Kindern und einer zarten Frau, nun roden
und urbar machen?! Da hätten auch die in
Aussicht gestellten Ochsen nicht helfen
können. Das war von Anfang an ein mehr
als fragwürdiges Unterfangen!
|
|
| |
|
 7.
Die schlimme Zeit in Vaseil 7.
Die schlimme Zeit in VaseilUnser
zu Hause war nun eine große Lehmhütte
mit Naturboden, Schilfdach, kein Fenster
und ein armseliger Türeingang. Links der
Hütte, in einem Kilometer Entfernung,
war der Urwald. Sonst war ringsherum
alles Sandwüste. Aus dem Urwald hörte
man das Gebrüll der wilden Tiere. Mutter
sagte kein Wort der Klage, und auch Vater
sagte nichts. Nun stellte sich heraus,
dass der Ziehbrunnen, der nahe bei der
Hütte lag, ausgetrocknet war. Mit einer
mitgebrachten Schaufel kletterte Vater in
den Brunnen, aber auch nach stundenlangem
Graben zeigte sich kein Wasser. Am
anderen Tage suchte Vater das von dem
Indianer bezeichnete Gewässer. Aber
dieses Wasser war faul. Jetzt ging Vater
zu der Farm. Am Abend brachte er dann
einen Schlauch voll Wasser und auch eine
reichliche Portion Mais mit.
Die Leute auf der Farm waren
ursprünglich Franzosen. Acht Männer,
zwei Frauen und viele Kinder lebten dort
ohne Kenntnis des Zeitgeschehens. Sie
wussten nicht, in welchem Jahr sie sich
befanden und hatten keine Religion. Sie
lebten vor sich hin und pflanzten sich
mit den Indianern fort. Jeden Monat kam
ein Gefährt aus Bellavista, einem
kleinen Urwaldstädtchen, und holte
Erzeugnisse von Rindern und Hühnern ab.
Dafür erhielten sie lebenswichtige
Sachen oder Geld. Einmal in der Woche
wurde ein fetter Ochse geschlachtet, der
am Feuer gebraten und auf einmal verzehrt
wurde. Die nächsten Tage tranken sie
Mate-Tee und aßen lediglich gequollenen
Mais. Dann bereicherten sie ihr Mal mit
Eiern, Milch und selbst geernteten
Apfelsinen und Zitronen, um nach einer
Woche wieder einen Ochsen aufzuessen.
Abends wurden Feldbetten aufgestellt, die
morgens zusammengeschlagen und an die
Wand gestellt wurden. Bettwäsche gab es
nicht. Unentbehrlich waren für alle
Moskitonetze, obwohl die Einheimischen
unter diesen Tieren nicht so sehr zu
leiden hatten wie die Europäer. Die
Männer trugen Überhänge aus Tierfellen.
Alle, auch Frauen und Kinder, waren wegen
der Temperatur sehr leicht bekleidet und
trugen keine Unterwäsche. Es gab nur
Erdböden, die nicht geputzt werden
brauchten. Mit diesem Leben waren sie
zufrieden.
In diese Farm ging nun Vater alle Tage
hin um dort zu arbeiten. Dafür brachte
er abends für Frau und Kinder den
Unterhalt und das nötige Wasser mit. An
eine Urbarmachung der Sandwüste war nach
wie vor gar nicht zu denken. So vergingen
die Wochen ohne Aussicht auf eine Wendung
der Verhältnisse.
Die Hauptbeschäftigung der armen
Mutter bestand tagsüber darin, mit
Stecknadeln einem Kind nach dem anderen
Sandflöhe aus den Füßen zu bohren, die
mit den eingelegten Eiern haufenweise wie
dicke Sagokörner anzusehen waren. Diese
Tierchen schmerzten furchtbar. Zudem kam
es oft zu Eiterungen, wenn zu spät
ausgebohrt wurde. Auch Vater hatte von
den Sandflöhen wehe Füße, und so war
zu befürchten, dass er eines Tages nicht
mehr zur Farm gehen konnte. Aber die Not
zwang ihn immer wieder und so ging er mit
den wehen Füßen täglich dorthin. Wir
alle liefen barfuss herum. Die von der
Heimat mitgebrachten Schuhe waren kaum
noch zu gebrauchen.
Einmal traf Vater in der Farm den
Führer des Ochsenwagens aus Bellavista.
Er konnte sich mit ihm gut verständigen
und ihm seine traurige Lage mitteilen. Er
sagte Vater, er hätte da eine Idee und
er solle doch ab morgen in seiner Hütte
bleiben. Und wirklich, schon bald danach
kamen drei Indianer hoch zu Ross. Sie
waren auch mit Fellen bekleidet. Diese
waren jedoch recht gepflegt und hatten
schöne Verzierungen.
Die Pferde hatten feine Sattel und
Zügel. Die Indianer sprachen vor den
Rossen stehend lange mit Vater und ritten
dann, schon fast vornehm grüßend, von
dannen. Vater sagte uns, dass die Männer
eingesehen hätten, wie nutzlos unter den
gegebenen Verhältnissen dieser
Wüstenaufenthalt sei und begriffen nicht,
welche Zusagen und Abmachungen dazu
geführt hatten. In allernächster Zeit
bekäme er Bescheid, was weiter geschehen
könnte.
In diesem Elend lebten wir schon den
siebten Monat! Hier gehörten wir nicht
hin. Die Sichtung des Sternes am
Ankunftstag hatten wir falsch gedeutet.
„Der steht ja auch immer noch da.
Das ist der Venusstern. Der wird auch
immer da zu sehen sein und zwar für alle
Menschen auf der Erde.“ Dies hatte
Mutter nun so erkannt. Sie machte uns
allerdings neuen Mut und sagte: „Die
Mitte der Nacht ist immer der Anfang
eines neuen Tages. Wir vertrauen
weiterhin Gottes Fügungen. Seine Wege
sind uns Menschen oft unergründlich aber
letztendlich doch richtig!“ Sogar
unser armer Vater gab sich Gottes Wege
hin und hat oft Psalmen gebetet.
Eines Tages kam Vater von der Farm und
sagte, dass uns am nächsten Tag ein
Ochsenwagen abholen würde. So geschah es
auch. Vater verabschiedete sich von der
Farm und brachte für den Weg in die
unbekannte Ferne einige geschlachtete
Hühner mit, welche Mutter zurechtmachte
und am Feuer briet. Sie bereitete auch
Mais vor. Zudem bereicherten auch einige
Sandias (Wassermelonen) den Reiseproviant.
|
 |
| Eine
argentinische Indiofrau. |
|
| |
|
 8.
Ein Laden in Villa Ocampo 8.
Ein Laden in Villa OcampoIn zwei
Tagen waren wir in Bella Vista. Dort
wohnten Mutter und wir Kinder vorerst in
einer Wirtschaft. Die Wirtin sorgte
wirklich gut für uns, worüber Mutter
sehr erstaunt war, weil wir doch nicht
bezahlen konnten. Vater fuhr indessen mit
einem Schiff über den Fluss Parana nach
einem Ort mit Namen Villa Ocampo, wohin
man ihn beordert hatte. Dort wurde ihm
unentgeltlich ein Haus überlassen, das
aus Ziegelsteinen gebaut war. Es hatte
ein gutes Dach, vier Räume mit je einem
Fenster und zwei Eingängen, aber keinen
Schornstein. In Ocampo fehlte ein
Verkaufsladen, und diesen sollten die
Eltern eröffnen.
Wir zogen in dieses Haus ein. Der
erste Raum wurde ein Verkaufsladen, der
zweite ein Lagerraum, und die anderen
Zimmer wurden Wohn- und Schlafzimmer.
Der Ort war sehr zerstreut und hatte
neben einer großen Zuckerrohrfabrik auch
eine Fleischfabrik. Viele Ausländer gab
es dort, besonders Franzosen und
Engländer. Die meisten hatten ihre
Familien in Buenos Aires wohnen, weil es
in Villa Ocampo keine Schule gab. In der
Mehrzahl waren hier die Indianer, die in
armseligen Behausungen lebten. Es gab
auch eine neue, wunderschöne Kirche im
Ort. Jeden Tag war hl. Messe, die ein aus
Frankreich geflüchteter Pastor las. Er
hatte die Kirche und auch das Pfarrhaus
erbauen lassen. Das Gotteshaus war nur
drei Minuten von unserem Haus entfernt.

Die Geschäfte gingen für Senor Pedro
Blümling eigentlich nicht schlecht, was
die Abrechnungen über gelieferte Waren
aus den Monaten enero (Januar) und
febrero (Februar) 1892 unter Beweis
stellen.
Alle Einwohner freuten sich darüber,
dass es nunmehr einen Verkaufsladen gab,
um den sich Mutter rührend sorgte. Vater
hatte mit der Zuckerfabrik die Abmachung
getroffen, dass er auf den Farmen das
Zuckerrohr aufkaufe und die Fabrik
beliefere. Das machte er zu Anfang recht
erfolgreich und verschaffte somit der
Familie eine zusätzliche Einnahmequelle.
In der Wildnis waren wir vor Hunger,
Durst und Geschwüren fast gestorben. Die
Füße waren zerfressen von den
Sandflöhen. Abends kamen die
Moskitoschwärme wie dicke Wolken heran
und richteten uns arg zu, da wir nur
provisorische Netze hatten. Entsetzliche
Hitze und Schmutz in der armseligen
Hütte, die keine Fenster hatte. Es gab
kein Wasser - weder für die Reinigung
des Körpers noch für die Wäsche. Mal
regnete es zwei Tage ununterbrochen und
wir vergingen dann fast vor Kälte.
Keinen Nachbarn, mit dem man einmal
hätte sprechen können, dagegen nur das
Gebrülle aus dem Urwald. Wie gut ging es
uns jetzt! Wir litten keine Not mehr! Ich
hätte nun gerne gewusst, auf welcher
Sprosse der Himmelsleiter wir uns jetzt
befinden. Sicherlich waren wir jetzt
mindestens eine Sprosse höher gekommen!

Die Landkarte zeigt die Lage von Villa
Ocampo (Pfeil)
Unserer, vom Schicksal nicht
verwöhnten Familie erschien das Haus,
die Betätigung und das Umfeld beinahe
wie ein Paradies. Vor Dankbarkeit gingen
wir jeden Tag zum Gottesdienst in die
Kirche. Sonntagnachmittags war Mutter-Gottes-Andacht.
Ein junger Spanier spielte auf einem
kleinen Harmonium immer dasselbe Lied:
„Lolate, lolate Maria, o Maria madre
mia …“ . Rudolf, der 7 Jahre
alt war, durfte schon bei der hl. Messe
dienen.
Was allerdings fehlte, war eine Schule.
Aber Vater tröstete uns und meinte, dass
wir in spätestens zwei Jahren so reich
wären, dass die Familie in die Stadt
ziehen könne, wo wir Kinder dann das
Versäumte nachholen könnten. Man muss
jedoch bedenken, dass zu jener Zeit 80%
aller Bewohner Argentiniens Analphabeten
waren und es die wenigen Volksschulen
fast nur in den Städten gab. Das Land
zählte nur ca. 4 Millionen Menschen. Es
hieß, dass vor einigen Wochen schon
einmal Lehrpersonen aus anderen Staaten
hier gewesen seien. Man hatte ihnen
schöne Wohnungen mit Garten und
eingerichtete Schulräume angeboten, was
jedoch nicht dazu verhalf, einen
Schuldienst im doch noch recht
abgeschiedenen Ocampo aufzunehmen, zudem
war auch die Bezahlung einer Lehrperson
von Anfang an nicht gesichert. Die
argentinische Republik legte keinen Wert
auf die Ausbildung der Ausländer und
Indianer. Somit unterblieb die Besoldung
der Lehrpersonen vom Staate aus.
Einmal kam eine Familie Geier aus
Essen in die herrliche Wohnung. Der Mann
war Lehrer und wegen
Studienstreitigkeiten geflüchtet. Er
hatte eine liebe Frau und zwei Kinder,
ein achtjähriges Mädchen und einen
kleineren Jungen. Wir freuten uns sehr
darüber und schlossen gleich
Freundschaft mit den netten Leuten.
Besonders ich freute mich, weil ich nun
eine Spielgefährtin hatte. Nachdem Herr
Geier seine Tätigkeit aufgenommen hatte,
waren wir die ersten ABC-Schützen. Es
kamen noch einige spanische Kinder hinzu,
deren Eltern kein großes Vermögen
hatten und buchstäblich am Hungertuche
nagten. Und entsprechend gering fiel eine
Vergütung an den Lehrer aus. Meine
Eltern alleine konnten ihn nicht bezahlen.
So war es nur zu verständlich, dass die
Familie Geier schon bald anderswo ihr
Glück versuchte. Es gab eben noch keine
vollständige Zivilisation in Südamerika
in den Jahren 1889 bis 1892, als wir dort
waren.
Nun wurde ich aufgrund der
mitgemachten großen Strapazen ernsthaft
krank. Ich litt oft unter sehr starken
Kopfschmerzen, die mich einmal fast an
den Rand des Todes gebracht haben. Vater
eilte weit fort, um einen Arzt zu holen.
Dieser verschrieb eine Medizin, die er
selbst aus Mitteln der Natur zubereitete.
Sie wirkte zusehends. Nur noch ab und zu
litt ich nunmehr unter den Schmerzen.
Dann stand das wirksame Mittel stetig zur
Verfügung. Allerdings hing mir eine
ständige Bronchitis nach. Aber was war
das alles im Vergleich zu dem, was nun
auf uns zu kam?
Es verbreitete sich das Gerücht, die
Schwarze Pocken seien in Ocampo
ausgebrochen. Moskitos, die in den
Sümpfen und Morasten immerfort gedeihen,
hatten diese schlimme Krankheit schnell
verbreitet. Und tatsächlich kam schon
bald ein in unserer Nähe wohnender
Indianerjunge von 20 Jahren in unseren
Laden einkaufen. Er zeigte auf seinen Arm,
der schon voller Pocken war und meinte,
dass er bald tot wäre, was so auch
eintraf. Es kam nun ein Arzt nach Ocampo
und impfte alle Ausländer. Bei den
Indianern hätte das keine Wirkung und
darum müssten alle sterben, war seine
Einstellung. In Wirklichkeit war es
jedoch so, dass die Regierung einen
sogenannten Ausrottungskrieg gegen die
Indianer führte. Diese sollten durch den
Zustrom europäischer Auswanderer ersetzt
werden. Man sah nun, dass aus allen
Hütten der Indianer Leichen heraus
getragen wurden. Wir wussten nicht, wohin.
Einige von den an Pocken Erkrankten
konnten wieder genesen, doch das Gesicht
war für immer von den zurückgebliebenen
Narben verunstaltet, was sehr schlimm
aussah.
Nun war die Epidemie vorbei und wir
waren mit dem Schrecken davon gekommen.
Es blieb weiterhin die große Sorge,
Schulkenntnisse für uns Kinder zu
erreichen, denn mit dem Fortgang des
Lehrers Geier waren alle Hoffnungen in
dieser Hinsicht vorbei. Dass die
heranwachsenden Kinder ohne
Schulunterricht waren, machte meinen
Eltern die größte Sorge.
Vater und Mutter hatten vollauf zu tun
bei den schweren Lebensbedingungen.
Vaters Tätigkeit wurde jedoch immer
öfter zu einer nutzlosen Anstrengung,
obwohl gefährliche Wege zu machen waren.
Dies wirkte auf ihn und auch auf die
Mutter erschütternd. Doch Vater meinte,
dass es ein Fehler wäre, aufzugeben.
Mutter blieb also nichts anderes übrig,
wochenlang mit den Kindern alleine zu
sein, was sie sehr bedauerte. Sie konnte
den Laden alleine bedienen. Die Indianer
waren sehr genügsam und anspruchslos.
Sie waren gut zufrieden zu stellen. Die
anspruchsvollen Ausländer waren in der
Minderzahl. Alles in allem war unser
Laden in Villa Ocampo eine feste
Institution. Der bescheidene Umsatz war
jedoch kaum zu verbessern. Der
Überschuss war entsprechend bescheiden.
So war wenig Aussicht auf Besserung der
gesamten finanziellen Situation. Hier
Vermögen anzusammeln, um dann in eine
Stadt zu ziehen, um dort ein solides und
gesichertes Leben zu führen, die Kinder
in die Schule gehen zu lassen, war
einfach nicht möglich. Das erkannte auch
ich, ein heranwachsendes Mädchen mit
einem Alter von jetzt 9 Jahren. Ja, das
Notwendigste zum Leben, was essen,
trinken und Kleidung betraf hatten wir
– mehr aber nicht. Keine Bildung,
keine Kultur, keine Geselligkeit, keine
Nachrichten. Wir lebten so dahin! Was war
noch von der Zukunft zu erwarten? Was
wird aus den Kindern? Bleiben sie
Analphabeten? Wir waren nunmehr schon ein
Jahr in Ocampo und traten förmlich auf
der Stelle.
Eines Tages geschah es, dass ein
Indianer eine Sandia verlangte, die neben
der Theke in einem Berg voller Früchte
lag. Ich stand mit dem kleinen Leo auf
dem Arm hinter der Mutter, die sich
bückte, um die Sandia zu holen. Da zog
der Indianer ein langes Messer heraus, um
der Mutter den Kopf abzuschneiden. Da
schrie ich: „Mutter, Mutter, der
Mann sticht!“ und die Mutter
schnellte wie der Blitz zurück. Der
Indianer floh von dannen. Einige Leute,
die meine schrecklichen Schreie gehört
hatten, eilten herbei und verfolgten den
Indianer. Nachdem sie ihn eingeholt
hatten, wurde er zur Administration
gebracht. Man brachte den Mann wieder zu
uns und ich musste aussagen, wie der
Verlauf war. Er wurde in Ketten gelegt
und verurteilt, für längere Zeit
Straßenarbeiten zu leisten.
Ein anderes Mal wurden die Mutter und
ich in der Nacht durch ein Geräusch wach.
Die Mutter flüsterte: „Man
bestiehlt uns“. Das Poltern wurde
immer anhaltender und schlimmer und unser
leises Beten immer inbrünstiger. Da
wurde auch Rudolf wach und sagte: „
Ich gehe einmal nachsehen!“ Die
Mutter verbot es ihm. Er war erst 7 Jahre
alt. Das Poltern hielt weiterhin an.
Endlich wurde es Tag und die
Schreckensnacht war vorbei. Langsam
standen wir auf und lugten durch einen
Türspalt. Da war eine große Öffnung in
der Ziegelwand und davor standen zwei
mächtige Ochsen, die sich Eingang
verschaffen wollten, um an Mais, Sandias
und andere essbare Sachen zu kommen. Die
Ochsen waren irgendwo davongelaufen und
wurden später von den Indos wieder
eingefangen. Das Loch in der Wand wurde
am selben Tag von guten Nachbarn
zugemacht. Dieser Schrecken war mal
wieder überstanden.
Unserem armen Vater standen die
Tränen in den Augen, als wir ihm die
Vorkommnisse erzählten. Dass auch dieser
Ort Ocampo nicht der rechte Platz sei
für unser ferneres Leben, wurde uns
immer klarer und durch all die
schrecklichen Erlebnisse und
Entwicklungen immer deutlicher.
Endlich kam ein großer Auftrag von
der Zuckerfabrik. Vater musste wieder
fort. Doch zuvor feierten wir 1892 noch
Ostern zusammen. Die Eltern gingen zur hl.
Kommunion. Für Vater waren es die
Sterbesakramente.
|
 |
| Gegenüber von
Bella Vista liegt Puerto Ocampo.
Auf dem Rio Parná, der zwischen
diesen beiden Orten liegt, ist
Peter Blümling tötlich
verunglückt. Das aktuelle
Satelitenfoto zeigt, wie
urwaldähnlich sich das
Sumpfgebiet noch heute darstellt. |
|
| |
|
 9.
Vaters Tod im Wirbelsturm 9.
Vaters Tod im WirbelsturmAm
Dienstag nach der Osterwoche verließ uns
Vater. Es geschah nun etwas Sonderbares,
was wir auch wieder als Gottes Zeichen
erkannten. An der einen Seite unseres
Hauses war eine lange, überdachte
Veranda – alles zu ebener Erde.
Mutter wusch dort gerade und ich spielte
mit dem Brüderchen. Da sah ich ein
großes Leuchten am Himmel. Auch Mutter
nahm es wahr. Wir konnten beide nicht
sprechen. Plötzlich rief Mutter:
„Das Leuchten kommt nach hier!“
Und dann war es fort. Es war ein großer
Komet, der auf die Erde zustürtzte, sich
in der Atmosphäre zerrieb und dann
erlosch. Mutter meinte in ihrem
unerschütterlichen Glauben, dass Gott
uns ein Zeichen gegeben hat, was wir noch
nicht deuten konnten.
Am folgenden Nachmittag kam ein
vornehm gekleidetes englisches Fräulein,
das schon öfter in unserem Laden
Südfrüchte gekauft hatte und fragte die
Mutter einleitend: „Ist ihr Mann auf
Reisen?“ „Ja“, antwortete
die Mutter. Darauf sagte das Fräulein,
ihre Mutter und noch eine Engländerin
seien auch auf Reisen gewesen. Da hätte
sie auch unseren Vater gesehen. Er sei
zur Überfahrt des Rio Paraná in ein
Schiff gestiegen. Auf diesem habe ein
Schiffmann bekannt gegeben, dass noch ehe
das andere Ufer erreicht wird, ein Sturm
zu befürchten sei. Die zwei Frauen seien
mit dem nächsten Zug nach Ocampo
zurückgefahren. Am nächsten Morgen
besuchte uns das Fräulein wieder. Ihr
war nun bekannt, dass das Schiff
tatsächlich in einen Wirbelsturm geraten
war und zerschellt ist. Nur sieben
Spanier seien gerettet worden und lägen
in Bellavista im Krankenhaus. Unser Vater
sei mit untergegangen, nachdem er sich
noch stundenlang mit aller Anstrengung an
einem Mast festgehalten habe und immer
gerufen hätte: „Meine arme Frau,
meine armen Kinder!“
Vater konnte nicht schwimmen. Aber
auch der beste Schwimmer der Welt hätte
sich in diesem wilden Urwaldfluss nicht
retten können.
Unsere arme Mutter setzte sich auf
eine Kiste und die Kinderchen setzten
sich zu ihr. Das englische Fräulein
tröstete uns und weinte mit uns. Als das
Fräulein fort gegangen war, schloss
Mutter den Laden und wir weinten und
weinten. Nach langer Zeit sagte dann die
Mutter: „Lasst uns auf Gottes Güte
vertrauen und beten wir zur lieben Gottes
Mutter, dass sie beim Herrn Fürbitte
leistet.“ Wir legten uns
schließlich mit den Kleidern aufs Bett
ohne etwas gegessen und getrunken zu
haben. Wir konnten nur weinen.
Beglaubigte Abschrift der
Todeserklärung:
„Ich bestätige, dass Peter
Blümling, einundvierzig Jahre alt, am 17.
April 1892, während der Nacht,
umgekommen ist infolge des Umsturzes
eines Bootes auf dem Rio Paraná zwischen
Puerto Ocampo und Bella Vista, auf
welchem Herr Blümling reiste mit anderen,
die ebenfalls umkamen. Der Herr Blümling,
ein in diesem Volke als arbeitsam und
ehrbar geachteter Herr hat seiner Gattin,
Frau Blümling, vier Kinder hinterlassen,
zwei Knaben und zwei Mädchen und noch
eines sehr nahe der Geburt.
SUP-DELEGATCION DE VILLA OCAMPO
Juli 28.1892
(Unterschriften)“
In welch schlimme Lage war nun Mutter
gekommen. Sie hatte keine
Sprachkenntnisse und war in einem fremden
Land. Vier kleine Kinder waren da. Das
fünfte wurde im November erwartet. Jetzt
war es April. Diesen Jammer zu
beschreiben, ist unmöglich! Ich glaubte
immer noch an die Himmelsleiter. Aber,
wie sollte man diese verstehen? Ich
glaubte schon, wir wären auf dieser
schon ein wenig hoch gestiegen.
Vielleicht war es ja auch so. Vielleicht
geht es im Leben nicht immer stetig
aufwärts. Das sollte ich als Kind auch
noch lernen. So waren wir alle, die
Mutter und auch die Kinder, wieder auf
der untersten Sprosse angelangt.
Ungeheuerlich hatte uns das Schicksal
wieder mitgespielt. Mit natürlichem,
menschlichem Verstand konnte man solche
Fügungen und Zulassungen Gottes nicht
verstehen.
Ich hörte, wie Mutter laut betete:
„Mein Gott, mein Gott – warum
hast du mich verlassen? Wo bist du –
großer Gott? Hast du uns vergessen? Ich
sitze hier in der Wildnis mit vier
kleinen Kindern! Was soll ich nun tun? Du
bist meine letzte Zuversicht!“
Und nun fiel uns das Zeichen, das wir
am Himmel gesehen hatten und das wir auf
uns zukommen sahen, ein. Schlug der Komet
nicht in Richtung Osten ein? – wo
Europa und das schöne Moselland liegt?
Zeigte nicht der Stern von Bethlehem den
hl. Drei Königen auch die wahre Richtung
an?! Wir glaubten weiterhin fest an
Gottes Vorsehung. Für Mutter stand nun
fest, die Reise geht zurück in ihr
geliebtes Neef. Die übernatürlich
denkende Frau mit der großen Liebe zu
ihren Kindern, hat immer nur Gutes und
Edles von ihrem Mann gesprochen, der
eigentlich nur eine glückliche Familie
um sich haben wollte in einem gesicherten
Wohlstand. Das Unternehmen
„Auswanderung nach Argentinien“
war gescheitert. Ein studierter deutscher
Bahnbeamter hatte hier in dieser Zeit
keine Chance – bei allem Einsatz,
gutem Willen und bei allen Entbehrungen.
Hier ging es auf der Himmelsleiter nicht
weiter. Hier konnte uns offenbar auch
Gott nicht helfen. Hier war für uns
keine Bleibe vorgesehen.
Zuerst erkundigte sich Mutter, wann
ein Zug nach Bellavista fahre, was in der
Regel nur einmal monatlich geschah.
Ansonsten fuhr der Zug auch schon mal je
nach Bedarf. Mutter nahm den erstbesten
Zug. Da waren wir Kinder ganz alleine. In
Bellavista traf die Mutter einen
Dolmetscher, der das Unglück auf dem
Fluss bestätigte. Zuerst ließ Mutter
ein Traueramt halten. Dann schrieb sie
einen Brief an ihre Stiefschwester in
Deutschland. Im Juli kam die Antwort:
„Komm! - Liebes Bäbchen, in Neef
haben Dich alle Leute noch so gern wie
vor 10 Jahren. Wenn Du auch noch so arm
nach Hause zurückkommst, jeder freut
sich, Dich wieder zu sehen.“
Das englische Fräulein war der Mutter
behilflich, dass sie von dem Inhaber der
Zuckerfabrik noch einige hundert Pesos
für gelieferte Ware erhielt. Nun
verkaufte Mutter alles, was noch im Laden
war. So kamen noch einige hundert Pesos
hinzu. Dies sollte eigentlich für die
Überfahrt reichen und auch noch etwas
für Unvorhergesehenes übrig lassen.
Von nun an lebte Mutter wieder auf.
Sie versammelte uns Kinder um sich herum
und erzählte von dem schönen Moselland.
„Und dort in Neef, wo ich meine
Jugend verbrachte, wo ich zur Schule ging,
wo ich im elterlichen Wirtshaus arbeitete,
wo die Leute lustig und fröhlich sind,
da gibt es den Petersberg mit herrlichen
Aussichtspunkten. Dort ist auch der
Friedhof für den Ort und mitten drinnen
steht die Peterskapelle. Im Ort, am
Flussufer, steht die Burg. In dieser
hielten sich in früher Zeit Grafen und
Ritter auf, die in der Matthiaskirche zu
hl. Messe gingen und auch dort getauft
und beerdigt wurden. Und diese
Matthiaskirche steht in der Nachbarschaft
meines Elternhauses.“ Wie spitzten
wir die Ohren, wenn Mutter so voller
Euphorie von dem Ort erzählte, wo wir
nun hinreisen würden. Ja, sogar Freude
kam auf, und wir konnten die Abreise kaum
erwarten.
|
|
| |
|
 10.
Nichts wie weg! – Die Fahrt aus der
Wildnis 10.
Nichts wie weg! – Die Fahrt aus der
WildnisEs war alles zur Abreise
fertig. Unsere Laune war recht gut. Waren
wir doch voller Hoffnung und Zuversicht
und war es doch der Start einer Reise
zurück zur Mosel.
Das Transportgefährt war zuerst
einmal wieder ein Ochsenwagen. Wir luden
unsere Habseligkeiten und uns auf und
fuhren zu einer Bahnhaltestelle, die als
solche kaum erkennbar war. Endlich kroch
mit viel Qualm begleitet ein armseliges
Bähnchen heran. Es gab Waggons mit
Sitzen und solche, die eher einem
Viehwagen glichen. Man saß in diesen
entweder auf dem Boden oder auf einer
einfachen Holzbank die rund um das Abteil
ging. Die Reisenden dort hatten zumeist
Tiere wie Hühner, Schafe und Ziegen
dabei. Sie fuhren vermutlich zum Markt
oder waren von einem solchen gekommen. Im
Zug sahen wir nur Einheimische. Darunter
waren wohl zur Hälfte Indianer. Uns
fünf „Blassgesichter“ wies der
Schaffner in ein eigenes Abteil mit
normalen Holzsitzen ein. Sicherlich hatte
der Zugführer Rücksicht genommen, weil
man Mutter die Schwangerschaft ansah und
zudem die vier Kinder und auch viel
Gepäck mit sich führte.
Die Fenster mussten wir zumeist
geschlossen halten, da ansonsten der
beißende Rauch von der Lokomotive in das
Abteil eindrang und die Augen heftig
tränen ließ. Der Zug war überbesetzt.
Er hielt ab und zu an, damit wir uns an
einem Ziehbrunnen oder an einer Quelle
erfrischen konnten.
Zumeist war dort eine Zuckerrohrplantage
oder auch eine Rinderfarm. Gerne nahm man
auch die Gelegenheit wahr, um ein
nötiges Geschäft zu erledigen.
Dies geschah jedoch nicht im Sinne des
Farmers. Er verfluchte und beschimpfte
uns dann in allergrößter Lautstärke.
Er scheuchte uns weg, als wären wir ein
Schwarm Ungeziefer.
Die Aborte im Zug waren in einem
katastrophalen und unbeschreiblichen
Zustand. An die Art der Verrichtung eines
„schnellen Geschäftes“ in der
freien Natur hatten auch wir uns bald
gewöhnt.
Auch wurden bei solchen
Kurzaufenthalten wilde Früchte, wie
Apfelsinen und Zitronen, geerntet, was
ein hoch willkommenes Labsal war. Beim
Ernten musste man höllisch aufpassen,
dass man nicht von Schlangen gebissen
wurde, die oft in den Bäumen lagen, sich
sonnten und nicht gestört werden wollten.
Scheinbar kannten auch die Affen die
Rastplätze; denn sie waren schnell
zugegen und stibitzten was sie nur
kriegen konnten. Einmal entwendete ein
Affe ein Kleidungsstück von einer Frau,
schleppte es auf einen Baum und machte
die unmöglichsten Faxen da oben.
Besonders die Kinder amüsierten sich
darüber köstlich. Ansonsten fuhren wir
viel durch baumlose Grassteppen, den
Pampas, wo schon mal halbwilde Rinder-
und Guanako-Herden (Lamas) grasten.
Nicht selten kam es vor, dass Tiere
den Weg versperrten. Zumeist waren es
Rinder, die dann durch helle Pfeiftöne
der Lokomotive abgeschreckt werden
sollten, was nicht immer gelang. Männer
sind dann ausgestiegen und haben die
Tiere von den Geleisen weg gedrängt.
Dies war nicht nur für uns fremde
Europäer ein lustiges Gaudi.
Wegen der freilaufenden Tiere fuhr der
Zug auch nicht bei Dunkelheit. Die Tiere
kuschelten sich in der Nacht gerne
zwischen den Geleisen ein, da diese die
Tageswärme gespeichert hatten. Und so
hätte es bei einer Nachtfahrt leicht
einen Aufprall geben können.
Schon mal mussten wir anhalten, da die
Lok Wasser und Kohle brauchte. Auch wurde
repariert oder geschmiert. Wiederum
stiegen dann die Fahrgäste aus und
machten notwendige Verrichtungen. Oft
stillten junge Mütter auch ihre
Säuglinge. Die Zugfahrt ging sehr
holprig vonstatten und war zum Stillen
nicht sonderlich geeignet. Wenn es weiter
ging, ließ der Lokomotivführer erst
einmal die Düse seiner Maschine laut und
schrill pfeifen – ein zweites Mal
– nach dreimaliger Aufforderung
mussten wir alle im Zug sein. Immer
wieder entstand Hektik bei dieser
Prozedur.
Nun kamen wir an einem Hafenstädtchen
am Paraná-Fluss an. Dort stiegen wir in
ein kleines Schiff um, das uns auf die
andere Seite brachte, wo wir wiederum in
einen Zug gleicher Art wie zuvor
umstiegen und weiter fuhren.
Die Reise insgesamt war abenteuerlich
und anstrengend. Aber unsere Stimmung war
nach wie vor recht gut. Zumeist schliefen
wir in der Nacht im Freien.
Einmal übernachteten wir in einem
Wirtshaus mitten in der Pampa. Es machte
von Anfang an einen sehr ungepflegten
Eindruck und war eigentlich eine
waschechte Spelunke. Der Zugführer gab
Mutter diese Empfehlung. Er verdiente
vermutlich an dieser Vermittlung. Nachts
war es sehr laut im Erdgeschoss – in
der Kneipe. Gauchos spielten Karten,
zockten, grölten, schimpften, lachten
und waren im Laufe der Nacht irgend wann
übermäßig alkoholisiert. Ab und zu
waren auch schrille Frauenstimmen zu
hören. Das ganze Haus roch nach Schnaps
und Tabak. Wir Kinder bekamen Angst und
kuschelten uns bei Mutter ein. Diese
hatte ihr kleines Säckchen mit dem Geld
vorsichtshalber unter ihrem Kopfkissen
liegen. Als dann die Raubeiner anfingen
melancholische Lieder zu singen, die von
einer Gitarre begleitet wurden, war das
recht faszinierend und sogar auch
schlaffördernd.
Und wenn wir zur Latrine mussten, dann
gingen wir allesamt in der Nachtkleidung
zum Hof. Eine Petroleum-Laterne stand im
Zimmer bereit und leuchtete uns auf dem
Weg. Keiner wollte im Zimmer alleine
bleiben, was auch Mutter nicht zugelassen
hätte. Auch auf dem Weg zur Latrine war
das Säckchen mit Geld nicht ohne
Aufsicht. Mutter hatte es unter dem Rock
versteckt. Als wir so über den Hof
gingen, gab das ein sehr lustiges Bild ab,
was die harten Kerls aus der Kneipe auch
so wahrnahmen und herzhaft darüber
lachten.
Am Morgen wuschen wir uns am
Ziehbrunnen. Wir stellten fest, dass
einige der zechenden Männer irgendwo
lagen. Sie schliefen ihren Rausch aus.
Auch unseren Zugführer konnten wir unter
diesen entdecken. Der Wirt weckte ihn und
stelle ihm ein Frühstück vor die Füße.
Er verzehrte es in aller Ruhe.
Doch dann hatte er es plötzlich eilig.
Schließlich ließ er die Lokomotive
wieder pfeifen und weiter ging die Fahrt.
Wir hatten alle eine recht gute Stimmung.
Wir waren wir mit dieser denkwürdigen
Unterbringung in dem zweifelhaften
Etablissement durchaus zufrieden gewesen
und hatten ein Abenteuer besonderer Art
erlebt. „Andere Länder –
andere Sitten!“ bemerkte Mutter.
Über den Aufenthalt in der Spelunke
unterhielten wir uns noch nachhaltig und
konnten darüber sogar lachen.
Mit dem Essen und Trinken kamen wir
zurecht. Das Leben der letzten Jahre
hatte uns zäh und anspruchslos gemacht.
An die ständigen Maisgerichte hatten wir
uns schon längst gewöhnt. Mais war für
alle hier das Grundnahrungsmittel. Und
wenn wir kein Wasser hatten, stand
irgendwo in der Natur eine Wassermelone
parat. Viele Farmen waren verlassen. In
den vormaligen Gärten fanden wir diese
oft in Fülle. Sie hatten sich offenbar
immer wieder fortgepflanzt.
Abends, gleich wo wir übernachteten,
suchten wir unseren Körper gegenseitig
nach Läusen und Flöhen ab. Daraus
machten wir regelrecht einen kleinen
Wettbewerb. Der Jüngste und Kleinste
unserer eingeschworenen Clique, der Leo,
war eifrig bei diesem Spiel dabei, was
uns alle amüsierte. Mutter musste
plötzlich laut lachen. Ihr fielen bei
diesem Spiel die Affen auf dem Rastplatz
ein, die sich ja in gleicher Weise
beschäftigt hatten.
Es hatte einige Tage gedauert, bis wir
in Buenos Aires ankamen. Wenn man jedoch
in Betracht zog, dass wir für diese
Entfernung ganze vier Wochen auf einem
rumpeligen Ochsenkarren für die Hinfahrt
in die Wildnis benötigten, konnten wir
mit diesem Transport zufrieden sein. Es
waren immerhin ca. 900 km, die wir mit
der Bahn zurückgelegt hatten. Und die
Bahnverbindung von Villa Ocampo bis
Buenos Aires war keine Hauptstrecke der
argentinischen Staatsbahn. Entsprechend
einfach, ja zum Teil provisorisch waren
die Streckenverhältnisse.
|
 |
Mit einem
solchen "Stahlross"
ging es durch die Wildnis
Foto: Manfred Zimmer |
| |
| |
 |
Ziegenhirt am
Bahngleis
Foto: Manfred Zimmer |
| |
| |
 |
Gaucho bei einer
Siesta
Foto: Manfred Zimmer |
|
| |
|
 11.
Die letzten Tage in Argentinien 11.
Die letzten Tage in Argentinien In
Buenos Aires kamen wir in ein großes
Hotel, in dem viele Passagiere
untergebracht waren. Alle warteten auf
die Abfahrt des Schiffes nach Antwerpen.
Vier volle Wochen dauerte es, bis es
endlich bereit stand. In aller Ruhe
konnten wir Vorbereitungen zur
anstehenden großen Reise über den Ozean
treffen. Dazu gehörten auch
erforderliche gesundheitliche
Untersuchungen.
Zur Mutter wurde gesagt, dass sie in
ihrem Zustand als schwangere Frau die
Reise nicht riskieren dürfe. Sie sei zu
zart von Natur aus und würde die auf sie
zukommenden Strapazen nicht überleben.
Aber Mutter bat so flehentlich, dass man
einsehen möge, dass sie nicht die Mittel
habe, bis zur Niederkunft im November zu
bleiben. Sie habe ein großes
Gottvertrauen und sie wisse, dass sie gut
in der Heimat ankommen wird. Schließlich
willigte man ein.
In Ocampo gab es eine andere Währung
als in Buenos Aires. Dies mag mit den
zerrütteten Verhältnissen im Staate
Argentinien in Zusammenhang gestanden
haben. Zwei Jahre zuvor, also 1890, gab
es einen Staatsbankrott. Der vormalige
„Peso moneda nacional“ war
durch neue Noten ersetzt worden.
Draußen auf dem Lande, in der Wildnis,
zahlte man noch mit der alten Währung.
Der Geldvorrat musste also auf einer
Wechselbank umgetauscht werden. Der
Hotelier riet Mutter, einen ihm bekannten
Dolmetscher mitzunehmen. Mutter zahlte
dann im Hotel die Überfahrt und die
Unterkunft.
Sie hätte eigentlich noch danach noch
900 Pesos übrig gehabt. Der Dolmetscher
stellte jedoch fest, dass ihr nur 800
Pesos zuständen, und ließ sich auch zu
keiner anderen Feststellung kommen. Er
sah von Anfang an nicht vertrauenswürdig
aus. Aber was sollte Mutter tun? Sie
hatte keine Sprachkenntnisse und war auf
die Empfehlung des Hoteliers und auf die
Einschaltung des Dolmetschers angewiesen.
100 Peso Verlust zu haben, war sehr
schmerzlich. Wie mühevoll hatte sie sich
das Geld zusammen gerafft.
Sie hatte sich ausgerechnet, dass ihre
Barschaft gerade so ausreichen könnte,
um die Reise und alles drumherum zahlen
zu können. Auch benötigte sie etwas
Geld für Neef. Sie wollte doch nicht
völlig mittellos dort ankommen. Mutter
war verzweifelt und weinte
herzzerreißend. „Warum, o Gott
immer diese Irrwege? Warum nun dieser
Wahnsinn?! Ich gehe zur Bank, um auf
normalste Art und Weise Geld zu wechseln
und bezahle ohne Einschränkungen meine
Schuldigkeiten. Warum nun dieser Betrug?
Wann verläuft denn ein Unterfangen
endlich einmal normal ab?!“ Wir
Kinder hatten mit Mutter großes Mitleid
und versuchten sie zu trösten. Wir
streichelten sie und sagten ihr, wie lieb
wir sie hätten und dass wir ja bald an
der schönen Mosel wären.
Dann trocknete Mutter ihre Tränen mit
einem verkrumpelten Taschentuch, das ihr
ganz lieb Rudolf reichte. Dies hatte sie
aufgemuntert und mit einem leichten
Lächeln sagte sie dann: „Kinder,
wir schaffen es. Lasst uns weiter auf
Gott vertrauen!“
Mutter nahm diese Reaktion von uns
Kindern zum Anlass, uns einmal groß zu
loben. Wir seien sehr lieb und geduldig.
Für wahr – wir spielten nur unter
uns zusammen mit primitivsten Spielzeug,
kannten keine Freunde und Freundinnen. Es
gab auch wenig Streit untereinander. Wir
waren in die Leidensgeschichte der Eltern
voll integriert und hatten immer wieder
Mitleid mit ihnen, waren von selbst aus,
ohne große Unterweisungen, brav zu ihnen
und zollten allergrößten Respekt. Wir
malten viel, und Mutter zeigte uns, wie
eine Burg aussieht, von denen es ja an
der Mosel so viele gibt. Ich brachte
meinen Geschwistern Lieder bei, die ich
noch von Elberfeld her kannte. Mutter gab
sich Mühe, mir Schreiben, Lesen und
Rechnen beizubringen, wovon auch Rudolf
und Werner etwas profitierten. Ansonsten
konnte ich meine Mutter doch recht viel
helfen und sie entlasten. So half ich auf
der Reise auch tatkräftig, das Gepäck
mit zu tragen. Auch Rudolf half dabei.
Wir wussten, dass Mutter viel Schonung
brauchte. Hatte man sie doch eigentlich
gar nicht nach Europa überfahren lassen!
Und dann? Ihr durfte nichts passieren!
Wir alle wollten doch unbedingt nach Neef
in das schöne Moselland! – wovon
uns Mutter so begeistert immer wieder
erzählte. Wir schonten Mutter, wo es nur
ging.
Es war Mitte August 1892. Mutter war
im sechsten Monat schwanger. Ich war 9,
Rudolf 6, Werner fast 6 und Leo 2 Jahre
alt. Mutter zeigte uns ihren dicken Bauch
und erzählte, dass sich das kleine
Geschwisterchen ab und zu bemerkbar macht.
Als wir auf dem Schiff waren wurde uns
das Hauptgepäck gebracht. Doch musste
Mutter feststellen, dass der große Korb,
in dem Kissen und Überbetten verpackt
waren, fehlte. Das Schiff sollte in 20
Minuten abfahren. Die Anlegestelle war
etwa 15 Minuten vom Hotel entfernt.
Mutter hatte also keine Zeit,
zurückzulaufen um im Hotel den Koffer zu
reklamieren. Der war uns gestohlen worden,
und bei dem Diebstahl wurde die knappe
Zeit bewusst mit einkalkuliert. Wer war
der Dieb? War es der Hotelier selbst? Ein
Angestellter von ihm? Der Transporteur?
Mutter schüttelte nur noch den Kopf und
schwieg.
|
 |
| „Deutsche-überseeische
Bank“, wo Mutter Barbara die
letzten Geldvorräte umtauschte,
um die Überfahrt bezahlen zu
können. Fotos aus dem
Informationsbericht über die
Reise nach Argentinien von Franz
Appel (Sign. A. III 7 (2)
genehmigt von der Handelskammer
Bremen. |
|
| |
|
 12.
Die Überfahrt nach Europa 12.
Die Überfahrt nach Europa Mit
einigen hundert Menschen glitt unser
Schiff aus dem Hafen. Die Bordkapelle
spielte eine spanische Hymne. „Adios
mi lindo Nation …“ (Auf
Wiedersehen mein hübsches Land) –
so hörte man es die Spanier mitsingen.
So waren wir nun auf dem Schiff ohne
Bettzeug. Zudem fehlte uns das Geld, das
gestohlen wurde. Mutter war jedoch
glücklich. Das sah man ihr an. Waren wir
doch nun auf der Heimfahrt. Sie erzählte
uns immer wieder von dem geliebten
Dörfchen an der Mosel. Dabei waren ihre
Gesichtszüge von einem freudigen
Schimmer überhaucht. Der Blick auf das
weite Meer schien uns geheimnisvoll,
etwas, was ich auf der Hinfahrt gar nicht
empfunden hatte.
Ich war allerdings damals erst sechs
Jahre alt. Auch wir Kinder konnten nun
die Ankunft in Neef kaum noch erwarten.
Die immer hochgemute Mutter wusste alles
zu meistern. Ihr Gottvertrauen kannte
keine Grenzen. Sie wusste, dass die
Zukunft nicht rosig aussehen kann. Sie
stand alleine mit bald 5 Kindern und war
eigentlich bettelarm.
In der Ferne sah man Schiffe mit
rauchenden Schloten. Kleine Krauswellen
tummelten sich spielerisch bei der
Berührung mit dem sandigen Ufer. Bei
sinkender Sonne war der Anblick besonders
schön. Buenos Aires wurde immer kleiner.
Als letztes hatte man noch Kirchen und
große Bauten gesehen.
Als das Schiff jene Stelle passierte,
wo der Rio Paraná in das Meer mündete
und Vaters Leiche längst dem Meer
übergeben hatte, betete Mutter mit uns
Kindern allerlei Gebete. Wir alle waren
sehr traurig, weinten und waren in
Gedanken bei Vater.
Ein deutschsprechender Matrose kam zu
uns und wusste zu berichten, dass sich im
Fluss räuberische Piranhas scharenweise
aufhalten. "Diese fressen alles, was
ihnen in die Quere kommt - sowohl lebende
Wesen als auch Kadaver jeglicher Art.
Somit erfüllen die Piranhas eine
wichtige Funktion zugunsten der
Reinerhaltung des Gewässers und
verhindern gefährliche Epidemien."
Was der Matrose sagte war sicherlich
richtig, aber es passte nicht zu unserer
Stimmung. Uns wurde ganz schummrig, und
Mutter musste sich eine Weile hinsetzen.
Nun gingen wir von Deck in den Raum,
wo das Essen ausgeteilt wurde. Es gab
Potaje (Gemüseeintopf) mit Tomatensoße
und Fisch. Dieses schmackhafte Essen gab
es des Abends öfters, darum habe ich es
im Gedächtnis behalten. Mutter bekam aus
der Erst- oder Zweitklassenküche immer
etwas Besonderes. In ihrem Zustand war
man um sie sehr bemüht. Solch gutes
Essen hätte sie überhaupt nicht
bezahlen können.
Abends kletterten wir in unsere Betten
– es waren eigentlich einfache
Holzkisten. So wurden diese
Schlafstätten auch allgemein Kisten
genannt. Es waren die einfachsten und
primitivsten Unterbringungen an Bord.
Für was Besseres hatten wir ja auch kein
Geld zur Verfügung. Unsere Kisten lagen
hoch. Das hatte den Vorteil, dass die
runden Fensterchen zu öffnen waren, und
wenn unter uns die Leute seekrank wurden,
das Erbrochene nicht auf uns strömte.
Wie fehlten uns jetzt die Kissen und
Laken, die man uns in Buenos Aires
gestohlen hatten. Für einen gewissen
Behelf hatte man gesorgt. So kuschelten
wir uns in Tüchern und
Stoffgegenständen jeglicher Art ein.
Trotz allem waren wir mit unseren
Unterkünften zufrieden und hatten keine
Schlafschwierigkeiten.
Das Schiff war viel kleiner, jedoch
gepflegter als das damalige
Auswanderungsschiff. So gab es sogar
Räume der ersten und zweiten Klasse.
Offensichtlich reisten Kaufleute, und
wohlhabende Weltenbummler mit. Wir hatten
unser Quartier ziemlich weit unten. Noch
tiefer lag nur das Deck, wo Schlachtvieh,
wie Kühe, Ochsen und anderes
eingepferchtes Getier, untergebracht war.
Dies war ein großer saalähnlicher Raum,
aus dem es furchtbar stank, was wir aber
im Laufe der Zeit nicht mehr so ekelhaft
empfanden als zu Anfang unserer Reise.
Ein eisernes schmales Treppchen ging
in die Höhe, als ginge es auf einen
Hochsitz im Wald. Ganz oben war dann eine
Kabine, in welcher der Kapitän seines
Amtes waltete, in dem er das Schiff
steuerte und die Matrosen kommandierte.
Interessant war es, den Kompass zu sehen.
Kaum vorstellbar war es für mich, dass
dessen Nadel immer nach Norden zeigte, so
dass sich der Kapitän immer orientieren
konnte. Ich war in allem sehr
wissbegierig. Viel zu gerne hätte ich
einen Schulunterricht gehabt, wo man
solches Wissen ja erlernt hätte.
So verging nun ein Tag wie der andere.
Wir blieben gesund und hatten sogar mit
der Seekrankheit nichts zu tun, was die
anderen Passagiere sehr bewunderten. Die
Wildnis hatte uns offenbar hart und zäh
gemacht.
Doch dann kam ein großer Regen mit
einem mächtigen Sturm. Die Wellen des
Meeres türmten sich und waren haushoch.
Zuletzt war das Tosen so stark, dass man
die Angstschreie der Menschen nicht mehr
hören konnte. Die Matrosen liefen
zwischen den Schreienden umher,
hantierten mit Segeln, Seilen und
Rettungswerkzeugen. Eine Katastrophe
schien sich anzubahnen. Bleich vor
Schrecken konnte man Leute im engen Raum
hin und her laufen sehen. Eine unsagbare
Furcht vor dem Tode hatte alle ergriffen.
Was nutzten da Rettungsgürtel und
Schwimmwesten, wenn das Schiff in diesem
schrecklichen Sturm unterging? Wir waren
in allergrößter Seenot mitten auf dem
Atlantik.
Keiner konnte uns helfen. Das Unwetter
dauerte zwei Tage und eine Nacht. Niemand
dachte an Schlaf oder Essen. Es war wie
eine Weltuntergangstimmung.
Mutter und wir Kinder blieben oben in
unseren Kisten. Und wieder fand Mutter
die passenden und tröstenden Worte. Sie
sagte uns, dass das Leben für jeden
einmal zu Ende ging. Der Tod gehört zum
Leben. Es sei von Gott bestimmt, wann
dies sein wird. Es gäbe keine irdische
Unsterblichkeit, auch wenn wir nicht in
den Wellen umkämen. Für alle Kreaturen
bliebe nichts als der Tod übrig. Nun
vermisste Mutter die Absolution eines
Priesters in dieser Todessituation. Aber
es gab keinen Priester auf dem Schiff.
Wir beteten immerzu: „Groß ist der
Herr und preiswürdig ohne Ende. Er
allein kann uns retten aus allen
Gefahren“ – so wie er es auch
getan hatte, als wir sieben Monate im
Urwald wohnten, umgeben von Gefahren, die
anders, aber eigentlich noch
schrecklicher waren als dieses Unwetter.
Endlich wurde es ruhiger. Ein älterer
Matrose, der sich José nannte, sagte uns,
dass er in den vielen Jahren seiner
Fahrten einen so entsetzlichen,
anhaltenden Sturm noch nicht erlebt hatte.
Der Kapitän gab bekannt, dass der
Kompass noch in Ordnung sei und das
Schiff die richtige Richtung hätte.
Man reichte uns ein reichliches Essen
und guten Kaffee. Wir waren wieder guter
Dinge und Mutter dankte in einem lauten
Gebet Gott Vater für die Rettung. Da
meinten wir Kinder, Mutter hätte mit
unserem Vater im Himmel gesprochen und
stellten uns vor, dass er uns nun schöne
Kleider, warme Bettwäsche und andere
nützliche Sachen schicken würde. Mutter
schmunzelte und ließ uns wissen, dass
sie zu dem lieben Gott gebetet hat, den
man Gott Vater nennt. Wir hatten große
Sehnsucht nach unserem Vater und konnten
immer noch nicht verstehen, dass er nie
mehr zu uns kommen würde.
Das Schiff ging bei günstigem Wetter
schnell voran. Wir hatten nun durch
Wassernot viel zu leiden, denn das süße
Wasser in den Vorratsbehältern ging zur
Neige. Das Meerwasser konnte man nicht
und durfte es auch nicht trinken. Es gab
zwar Sprudelwasser zu kaufen, aber wir
hatten ja ein knapp bemessenes Geld und
mussten ja auch noch eine kleine Reserve
für die Heimat haben. Der Durst war
schrecklich.
Ich bekam wieder meine heftigen
Kopfschmerzen. Mutter schickte mich aufs
Deck um frische Luft zu atmen. Mit
großer Mühe kletterte ich die eiserne
Treppe hinauf und setzte mich dort hin,
wo niemand war. Aber auch hier war es
unerträglich und zwar wegen der großen
Hitze. Wir befanden uns in der Nähe des
Äquators. Ich war fast ohnmächtig, als
mich ein Matrose fand, der mich wieder
hinunter zur Mutter brachte. Der
Schiffsarzt wurde gerufen. Er war es, der
sich auch jede Woche einmal nach dem
Befinden der Mutter erkundigte. Der Arzt
gab mir ein wirksames Mittel und so nach
und nach ging es mir wieder besser.
Der Kapitän, der sich rührend um
Mutter sorgte, hatte schon längst
erraten, dass sie viel Kreuz und Leid
trug. Er brachte ihr die Passagierliste
und sagte, so gut er Deutsch konnte, dass
sich in der ersten und zweiten Klasse
wohlhabende und bedeutende
Persönlichkeiten befänden und fragte
Mutter, ob sie mit dem einen oder anderen
bekannt werden möchte, der ihr
vielleicht in ihrer Lage behilflich sein
könnte. Mutter lehnte ab. Sie fühlte
sich zu einfach und hätte ja auch keine
Sprachkenntnisse, um mit solch vornehmen
Leuten ins Gespräch zu kommen. Auch
fürchtete sie, dass jemand Gefallen
finden könne an ihren schönen Kindern.
Nicht um alles in der Welt würde sie
eines davon adoptieren lassen. „Ich
bleibe bei euch!“ Eine
lebensgefährliche Frühgeburt, was der
Arzt nicht ausgeschlossen hatte, schloss
sie aus. Das wird Gott nicht zulassen!
Der Matrose José war besonders nett
zu uns und hatte uns in sein Herz
geschlossen. Er gab uns schon mal sein
Fernrohr und wir konnten so in weiter
Ferne Schiffe sehen, die mit bloßem Auge
nur als winziger Punkt zu erkennen waren.
Er freute sich auch, dass wir
Naturschönheiten so herzhaft und ehrlich
bewunderten. Einmal weckte er uns ganz
früh, als es noch dunkel war, damit wir
den Sonnenaufgang erleben konnten. Mutter,
Rudolf und ich gingen auf das noch
menschenleere Deck. Hell und klar
leuchteten die Sterne am wolkenlosen
Himmel. Und nun sahen wir ihn wieder, den
hell leuchtenden Stern. „Das ist der
Planet Venus. Er ist am Morgen der
Vorläufer der Sonne und geht am Abend
nach der Sonne unter.“ Der Matrose
erklärte uns dies und zeigte uns auch
den großen Wagen und den Nordstern. Als
wir ihm erzählten, wie wir diesen Stern
als Zeichen Gottes in der Wildnis
erkannten, lachte er.
Die Venus hat seit Millionen von
Jahren ihren stetigen Lauf. Da kümmert
sich Gott nicht mehr drum. José nahm nun
seine Schiffslaterne und ging auf dem
Deck umher. Er hatte Nachtwache. Mal
hatte er am Segel etwas zu korrigieren,
mal ging er Geräuschen nach, die aber
zumeist von Ratten verursacht wurden.
Die Menschen an Bord lagen im tiefen
Schlaf. Wir setzten uns auf eine Bank und
erlebten den einzigartigen schönen
Einzug eines jungen Tages auf dem Meer.
Ein rosiger Schimmer am Rande des Meeres,
weit, weit in der Ferne, zog sich am
Himmel entlang. Das allein war schon
wunderbar anzusehen. Der große
Morgenstern versank in die pechschwarze
Nacht und wo erst der rosige Streifen zu
sehen war, kam nach und nach die
Feuerkugel Sonne heraus und stieg höher
und höher. Es war wirklich ein Erlebnis
zu sehen, wie die blitzenden, funkelnden
Wellen des Meeres die Strahlen der
aufgehenden Sonne weiter trugen. „So
groß ist Gott! Wie können oder dürfen
wir da verzagen?“ stellte Mutter
fest. Und mir kam in den Sinn, wie
undankbar ich schon gewesen bin und mit
Gott gehadert habe, weil er all dies
erlebte Unglück zuließ. Muss man erst
ein solche Naturschauspiel gesehen haben,
um fest an Gottes Existenz zu glauben?
José kam nun hinzu und belehrte uns,
dass die Sonne, die soeben aufgegangen
war, bei anderen Völkern jetzt
untergegangen sei. Rudolf und ich waren
stark beeindruckt.
Nach diesem schönen Erlebnis hatten
wir am Tage wieder eine schreckliche
Gluthitze, so dass wir vor Durst fast
verschmachteten. Da kamen auf einmal
Leute die sagten, der Koch habe einen
Hitzschlag bekommen und sei tot. Gegen
Abend wurde schon die Leiche mit Stricken
ins Meer versenkt. Wir sahen mit vielen
anderen Passagieren zu, ohne dass jemand
betete. Mutter war unten geblieben, und
wir erzählten ihr, was geschehen war.
Als Rudolf und ich einen Leuchtturm
sahen, teilte uns José mit, dass wir
dorthin fahren und kurz ankern würden.
Wir hatten schon die Kanarischen Inseln
erreicht. Der große Ozean war schon
überquert. Am Morgen erreichten wir die
Küste. Endlich, endlich wurden die
Wasserfässer gefüllt. Obst und alles
Mögliche wurde angeschafft. Viele kleine
Boote kamen angefahren.
Händler wollten vielerlei Dinge
verkaufen. Es entstand ein lebhaftes
Treiben rund um unser Schiff. Mutter
kaufte uns eine Melone, die wir aber erst
am nächsten Tag essen durften, weil wir
viel Wasser getrunken hatten. José
schenkte jedem von uns Kindern eine
Apfelsine. Dann legte unser Schiff wieder
ab. Wir hörten noch eine Weile ein
wunderschönes Konzert vom Lande her.
An einem anderen Tag sahen wir
plötzlich zwei Haifische, deren Körper
großen Pferden ähnlich sahen. Es waren
Walhaie, die bis zu 20 m lang und über
12 Tonnen schwer werden können. Es sind
die größten Haie, die es in den Meeren
gibt. Sie schwimmen gerne hinter Schiffen
her und laben sich an den Fäkalien, die
sie wie Plankton in ihren Kiemen filtern
und als Nahrung aufnehmen. Als sie in die
Nähe des Schiffes kamen, schossen die
Matrosen auf die Tiere. Sie sagten, dass
die Fische so stark seien und dass sie
ein Schiff umwerfen können, wenn es
ihnen gelänge, unter das Kiel zu kommen.
Dort, am Boden der Schiffe, finden sie
oft die Ausflüsse, die sie begehren. Wie
eine Nussschale seien schon große
Schiffe von solchen Haien umgekippt
worden. Vielleicht wurde aber hier auch
ein wenig Seemannsgarn gesponnen, für
das ja die Matrosen bekannt sind. Wir
Kinder waren jedoch voll beeindruckt von
dem Geschehen und von dem Gesagten. Nach
dem Schießen merkte man an den Wellen,
dass die Tiere davon schwammen. Nun war
auch diese Gefahr überstanden.
Je näher wir unserem Ziele kamen,
desto stiller wurde Mutter, die uns
ansonsten doch so gerne von Neef und den
lieben, guten Leuten dort erzählt hatte.
Und hatte sie so inbrünstig erzählt,
dass Rudolf und ich wahre Luftschlösser
aufbauten, die wir nun bald in Neef zu
finden hofften. Wir meinten, dort ein
schönes Haus aufzufinden mit einem
großen Garten, in dem wir
Versteckspielen und Blumen pflücken
konnten. Hätte uns Mutter zugehört,
hätte sie uns gewiss so schonend wie
möglich eines Besseren belehrt.
Antwerpen war erreicht. Mit allen
Kisten, Körben und Paketen erreichten
wir mühsam die Bahn. Der freundliche
Zugführer wies uns ein eigenes Abteil an.
Er kontrollierte unsere Fahrkarten,
zog die Vorhänge des Raumes zu und
brachte ein Schild an die Außentüre an
auf dem in niederländischer Sprache
vermutlich stand „wir schlafen und
wollen nicht gestört werden“ –
oder so ähnlich. Er sah uns die
Strapazen der Schiffsreise an und gönnte
uns einen guten Schlaf. Das war sehr gut
gemeint und hatte auch den gegönnten
Erfolg.
Der Zug hielt in Köln als wir
aufwachten. Mutter zog die Verdunkelung
weg. Und nun sahen wir den großen Dom.
Wir waren sprachlos, als wir das
mächtige Bauwerk sahen. Auf der weiteren
Fahrt waren wir wie aus dem Häuschen.
Wir sahen die vielen Burgen und die
sauberen weißen Schiffe auf dem Rhein,
die Weinberge und die idyllischen Dörfer
und Städtchen mit den Fachwerkbauten und
den blauen Schieferdächer. Wir waren in
einer anderen Welt.
In Koblenz angekommen, schrieb Mutter
schnell eine Karte nach Neef und teilte
mit, dass wir am nächsten Tag ankämen.
Nachdem Mutter am Gepäckschalter alle
Habseligkeiten aufgegeben hatte, gingen
wir in ein Hotel, wo uns der Portier im
dritten Stock ein Zimmer anwies. Dort
machten wir uns endlich einmal wieder
gründlich frisch, was gut tat. Nachdem
wir noch etwas gegessen hatten, legten
wir uns zur Ruhe und schliefen in den
frischen Federbetten wie eine
Königsfamilie in einem Schloss. Am
anderen Morgen gingen wir noch in die
Stadt zu einer Bank und wechselten unsere
noch vorhandenen Devisen um. Dann
kleideten wir uns in einem Kaufhaus ein
wenig besser ein. So, wie wir angezogen
waren, wollte Mutter in Neef nicht
erscheinen. Das Geld war aber auch danach
bis auf einen Rest aufgebraucht. Und
diesen benötigte sie in Neef für einen
Neuanfang. Wie gut und klug hatte Mutter
doch mit dem wenigen Geld, das ihr zur
Verfügung stand, gewirtschaftet!
Wir gingen nach dem Einkauf noch
einmal in unser Hotelzimmer und waren
reisefertig. Doch als wir zur Tür hinaus
wollten, ließ sich diese
merkwürdigerweise nicht aufmachen.
Mutter probierte alles. Sie klopfte, rief
und wir alle schlugen mit unseren
Fäusten die Türe fast ein. Es kam kein
Mensch. Anscheinend waren wir die
einzigsten Hotelgäste im dritten Stock.
Es gab auch keine Schelle. So warteten
wir ganz verzweifelt drei Stunden und um
ein Uhr am Mittag wollten wir in den Zug
nach Neef einsteigen. Dann, endlich,
hörten wir vor der Tür eine männliche
Stimme. Man öffnete die Türe und es
stellte sich heraus, dass Leo oder Werner
im Spiel unten an der Türe einen
Sicherheitsriegel eingeschoben hatten.
Der Mann, der uns behilflich war, sagte,
dass er rein zufällig im dritten Stock
etwas zu tun gehabt habe.
Nun ja, dies Geschehen konnten wir als
kleine Episode in dem Drama
„Auswanderung nach Argentinien“
abhaken. Wir bekamen noch einen
kostenlosen Kaffee für den erlebten
Schrecken eingeschenkt und saßen dann
schließlich um drei Uhr mit Sack und
Pack im Zug.
Die Moselstrecke gefiel uns noch
besser als die Rheinstrecke. Das Tal war
noch enger, die Weinbergshänge noch
steiler, die Dörfer noch kleiner und
immer wieder Burgen, Schlösser, Burgen.
Auch die vielen Kirchen, von denen jeder
Ort mindestens eine hatte, fielen uns auf.
Um fünf Uhr erreichten wir Neef.
|
 |
| Mit dieser Truhe
kam die hochschwangere Witwe
Barbara mit vier Kindern in Neef
an. Die Truhe verwahrte die
letzten Habseligkeiten. |
| |
| |
 |
Übernachtung im
Zwischendeck
Copyright:
Deutsches Auswandererhaus / Foto:
Werner Huthmacher |
| |
| |
 |
Wir nannten
unsere Betten "Kisten"
Copyright:
Deutsches Auswandererhaus / Foto:
Werner Huthmacher |
| |
| |
 |
So speisten die
Reisenden in der ersten und
zweiten Klasse
Copyright:
Deutsches Auswandererhaus / Foto:
Werner Huthmacher |
| |
| |
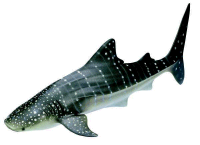 |
| Walhaie
schwimmen gerne hinter Schiffen
her und laben sich an den
Fäkalien |
| |
| |
 |
| Diesen Schuh
trug der kleine Leo auf der
Überfahrt. Seine Tochter
Rosemarie hatte ihn in Verwahrung
und ist jetzt im Besitz des
Autoren. |
|
| |
|
 13.
Zurück in Neef 13.
Zurück in Neef Die Tante Käthe,
Mutters Stiefschwester, und Ev-Tante
waren zum Abholen am Bahnhof. Diese zwei
Frauen weinten, fielen der Mutter um den
Hals und waren sehr lieb mit uns Kindern.
Dann sagte Käthe-Tante: „Nun kommt,
ihr seid herzlich willkommen.“ Das
Neefer Bäbche war wieder zu Hause!
Diese Käthe-Tante hatte ein großes
Haus an der Mosel. Ihr erster Mann hieß
Kreuter, der Jetzige Gietzen. Sie hatte
zwei Söhne und zwei Töchter, wovon 1892
noch drei schulpflichtig waren. Der Onkel
Michael Gietzen stand an der Tür und
empfing uns herzlich. Die Kinder kamen
und wollten mit uns sprechen. Aber wegen
des für unsere Ohren furchtbaren
Plattdeutsch verstanden wir kein Wort.
Erst wurde Kaffee getrunken. Dann
überließ uns die Tante zwei große und
helle Zimmer. Die Tante meinte, wir
sollten bei ihr bleiben, bis in zwei
Monaten das Kind geboren sei.
Wie hatte sich Neef für Mutter
verändert? Bis auf einige wenige
Besuchstage von Elberfeld aus war Mutter
ja ganze 10 Jahre nicht mehr im Ort
gewesen.
Die Matthiaskirche wurde klerikal
nicht mehr genutzt. Aus dem Kirchenschiff
hatte man eine Scheune gemacht. Ein neues
wunderschönes Gotteshaus wurde schon ein
Jahr zuvor eingeweiht. Es gab neue
Häuser im Dorfdistrikt
„Neugarten“. Und viele Leute
blieben bei Mutter stehen und redeten und
redeten mit ihr. Man freute sich und war
neugierig. Man wollte wissen wie es in
Argentinien war, wie die Wilden aussahen,
welche Tiere es dort gab, wie der Ozean
überquert wurde und vieles mehr. Wenn
die Rede auf Vaters Tod kam, wurden alle
traurig und Mutter weinte dann.
Wie schwer war es für Mutter, als sie
ihr früheres schönes Haus mit dem
Garten sah. Auch die herrlichen Weinberge
in den besten Lagen, die fruchtbaren
Gärten und die saftigen Wiesen. Alles
war weg. Alles dies gehörte ihr nicht
mehr. Nun war sie bettelarm. Einmal sah
ich, wie Mutter händeringend am Fenster
stand und sprach - ja beinahe rief:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du
mich verlassen!“ Es waren die Worte,
die sie auch schon bei der Nachricht von
Vaters Tod in voller Verzweiflung an
unseren Herrgott gerichtet hatte. Ich
weinte mit Mutter. Auch ich konnte Gott
nicht verstehen. Auf alle meine Fragen an
ihn bekam ich keine Antwort. Aber hatte
nicht Jesus auch diese Frage an Gott
Vater gerichtet, als er am Ölberg seien
schlimmen Leidensweg antrat? Weshalb
hatte Gott nicht seinem eigenen Sohn
geholfen? Er hatte doch die Macht dazu!
Gottes Wege sind unergründlich und
letztendlich stellt man fest, dass sie
richtig und weise sind. Diese Erkenntnis
gab uns Hoffnung.

Das Foto aus dem Jahr 1897 zeigt den Ort
Neef, wie man ihn 1892 vorfand. Das
Schiff der damaligen Matthiaskirche und
auch das elterliche Gasthaus sind bei
genauem Hinsehen noch zu erkennen.
Nachdem 1891 schon die neue Kirche
geweiht wurde, hat man das Schiff der
alten Matthiaskirche versteigert. Es
wurde von Michael Bremm erworben, der es
mitsamt der Sakristei abgerissen hat.
Später, als die angrenzenden Wohnhäuser
einem Brand zum Opfer fielen, wurde
dorthin ein stattliches Wohnhaus erstellt,
in dem auch die Gaststätte "Zum
Frauenberg" untergebracht war.
Mutter sagte, da in Neef nur ein
kleiner Krämerladen sei, wolle sie ein
Geschäft eröffnen, wenn sie eine
geeignete Wohnung mitten im Dorf fände.
Das Haus der Tante war wegen der
abgelegenen Lage nicht geeignet. Mutter
fühlte sich stark und wollte noch vor
dem Winter anfangen, sobald sie eine
Wohnung gefunden habe. Ihr Barvermögen
betrug etwas über 200 Mark. Natürlich
war damit nicht viel anzufangen. Es war
ein Überlegen hin und her.
Da wollte Mutter in Senheim bei Vaters
Verwandten um Unterstützung nachfragen.
Die Familie Blümling gab es im Ort nicht
mehr, aber es lebten dort von der
Großmutter selig vier ledige Tanten und
ein lediger Onkel in einem schönen und
großen Haus. Eine Tante kümmerte sich
um Stall und Vieh, eine um die Weinberge,
die dritte um Haus und Küche, und die
vierte spann Leinwand, nähte und
kümmerte sich auch um die Paramente der
Kirche (Altardecke, Fahne etc.). Der
Onkel half, wo es fehlte. Sieben Fuder
Wein ernteten sie in guten Jahren. Somit
war ein gewisser Wohlstand dort.
Vor dem Fest Kreuzerhöhung, am 14.
September 1892, fuhr uns der älteste
Sohn der Tante mit einem Kuhgespann über
den Berg nach Senheim. Brav und artig
saßen wir Kinder auf einer Karre. Mutter
hatte ein besonders dickes Sitzkissen als
Unterlage. Der Weg war nämlich holprig
und hatte tiefe Furchen. In ihrer
Situation hätte sie die Fahrt eigentlich
nie und nimmer unternehmen dürfen. Aber:
„Es muss ja weitergehen!“ sagte
sie.
Der Empfang stellte sich ziemlich kalt
dar. Das erste, was sie sagten, war:
„Wie konnte Peter so etwas machen?“.
Mutter antwortete: „Es ist geschehen
und es ist schwer zu ertragen mit vier
kleinen Kindern, das fünfte unter dem
Herzen, der Ernährer im fremden Land
ertrunken, ein herziges Töchterchen
Lucia vor Hunger in Buenos Aires
gestorben und jetzt mittellos“. Da
flossen wohl ein paar Tränen, aber
helfen konnten (wollten) sie nicht. Mit
uns Kindern waren sie gut und bewirteten
uns reichlich acht Tage lang. Dann wurden
wir von unserem Cousin, der uns auch
hingebracht hatte, wieder abgeholt, ohne
dass uns im geringsten geholfen wurde.
Zwei Pfund Butter und zwei Brote gab man
uns lediglich mit. Was waren das nur für
Christen gewesen? Wie leicht hätten sie
Mutter helfen können? Sie benötigte
lediglich ein kleines Startkapital zur
Eröffnung eines Ladens. Ein
zinsgünstiger Kredit hätte sehr helfen
können! Doch in Gottes Blumenstrauß
gehören auch Disteln. Mutter verglich
die Menschheit immer mit einem großen
bunten gemischten Blumenstrauß aus dem
Felde. Sehr enttäuscht kam man in Neef
wieder an. Auch andere Neefer Leute
konnten das Verhalten der Verwandtschaft
in Senheim nicht verstehen.
Auch die Wohlhabenden in Neef hielten
sich zurück. Sie konnte sogar spitze
Bemerkungen hören: „Selbst schuld
– warum hast du diesen Fremden
geheiratet – die Neefer Burschen
waren dir ja nicht gut genug - wie
könntest du es so schön haben, wenn du
den Blümling nicht geheiratet hättest?!“
Doch darauf gab Mutter niemals eine
bedauernde Antwort, sagte aber oft zu
ihnen: „Mein Mann war ein Charakter
und die Religion war ihm Herzenssache.
Gewiss hatte er eine Strenge an sich,
aber ich vertraute ihm wie auf meinen
Gott, und wie es gekommen ist, war es
Gottes Wille.“
Da endlich bot die Witwe Anna Maria
Budinger an, bei ihr zu wohnen. Das Haus
war mitten im Dorf. Wir durften Keller,
Speicher, Scheune und zwei Zimmer im
Erdgeschoss benutzen. In einem davon
richteten wir einen Laden ein, der zuerst
provisorisch und sehr einfach war.
Mutter kannte von früher in Cochem
einen soliden Mann namens Bauer. Er
belieferte schon damals die elterliche
Gastwirtschaft mit Essenswaren. Er
stellte uns kostenlos eine schon etwas
ältere Ladeneinrichtung, die er übrig
hatte, zur Verfügung. Herr Bauer war
nicht verheiratet und hatte ein
Kolonialwarengeschäft. Er belieferte
Mutter auf Kredit mit allem, was ein
Haushalt brauchte in Kartons und Säcken.
Von dem, was in den Keller kam, wie
Rübenkraut, Heringe und Sauerkraut,
bekamen wir je ein Tönnchen. Herr Bauer
hatte einen jungen Gehilfen. Es war der
Mathias Stolz. Er kam aus der Eifel und
war sehr tüchtig. Mit ihm hat Mutter gut
zusammen gearbeitet. Mit Kartoffeln und
Gemüse half einstweilen Tante Käthe,
und mit Milch die Ev-Tante aus und das um
Gotteslohn. Der Anfang war gemacht! Eine
Existenz war gegründet! Auf ein
Heiratsangebot von Herrn Bauer ging
Mutter nicht ein, was aber nur eine
zeitweilige Verstimmung verursachte.
Als die Leute sahen, was wir für eine
fleißige Familie waren, staunten sie und
halfen uns so viel es nur möglich war.
Es war erstaunlich, wie Mutter das alles
so schnell organisiert hatte. Sie war mit
viel Freude bei ihrer Arbeit und war wohl
eine geborene Geschäftsfrau. Hier
gehörten wir hin! Hier wurde eine
Sprosse nach der anderen auf der
Himmelsleiter erklommen!
Viele Familien waren arm, aber sie
kauften, was sie benötigten, bei uns. Es
war ganz rührend, wie sie alle Mitleid
mit uns hatten. Wenn jemand nicht sofort
zahlen konnten, was immer wieder vorkam
und auch Gründe hatte, dann wurde dies
in einer Kladde festgehalten. Irgendwann
wurde bezahlt. Es gab keine Ausfälle.
Auch unser Fräulein Lehrerin
Katharina Limbach war sehr nachsichtig
mit Maria, die mit 9 ½ Jahren noch keine
Schule besucht hatte. Mit ihrer
besonderen Hilfe kam ich in der Klasse
noch mit. Frl. Limbach hatte, als sie in
Neef begann, bei uns in der Wirtschaft
gewohnt. Sie kannte und schätzte Mutter
noch von damals. Nur unser armer Rudolf
fand bei den beiden Lehrern Blankenheim
und Heuscher kein Verständnis und hatte
unter ihrem Regiment viel zu leiden.
Werner hatte da im Laufe der Zeit weniger
Schwierigkeiten mit dem Schulunterricht.
So war unser Anfang geglückt und wir
waren erst im Oktober – erst einen
vollen Monat in Neef. Und jetzt konnte
Mutter der Geburt ihres sechsten Kindes
in Ruhe entgegen sehen.
|
 |
| Käthe-Tante |
| |
| |
 |
| Ev-Tante |
| |
| |
 |
| Gasthaus
„Zum Frauenberg“ |
| |
| |
 |
| Das Haus
Budinger wurde im letzten
Weltkrieg zerstört und existiert
heute nicht mehr (Foto von Helga
Mentges, Bullay. Ihre Mutter war
eine geborene Budinger) |
| |
| |
 |
Links auf dem
Bild die Witwe Anna Maria
Budinger im betagten Alter Rechts
daneben Johann Budinger
(Foto von Helga Mentges, Bullay.
Ihre Mutter war eine geborene
Budinger) |
|
| |
|
 14.
Neubeginn und Alltag 14.
Neubeginn und Alltag .Die
Auswanderung der Familie Peter Blümling
und die Rückkehr nach Neef hatte nicht
nur den engen Familienkreis und die
Neefer Bevölkerung beschäftigt, auch
Leuten außerhalb des Ortes ging dieses
Drama sehr nahe. So konnte auch die
bekannte Schriftstellerin Clara Viebig in
ihrem Roman „Die Goldenen
Berge“, in der sie auf Land und
Leute in Bremm und Neef eingeht, auf eine
kurze Erwähnung der Neefer Auswanderer
nach Argentinien nicht umgehen.
Vom zweiten auf den dritten November
mussten wir alle bei der Tante schlafen.
Am anderen Morgen wurde uns gesagt, wir
hätten ein kleines Brüderchen bekommen.
Ich hätte eigentlich lieber ein
Schwesterchen gehabt, da ich doch schon
drei Brüder hatte. Da war ja wohl nichts
mehr dran zu ändern. Nach einigen Tagen
fanden wir unser neues Brüderchen
herrlich und goldig, und auch ich war nun
mit ihm voll einverstanden.
Das Kind wurde auf den Namen Franz
Josef getauft. Tante Käthe’s
Tochter Barbara war Got (Patin) und
Vaters Cousin Franz Schneider war Pate.
Beide beschenkten das Kind mit Kleidung
für den nächsten Sommer.
Ich konnte nun für einige Wochen
nicht in die Schule gehen, da ich Mutter
mit dem Säugling betreuen musste. Die
Tummese Beb, eine stille und brave Frau,
besorgte den Laden. Andere Frauen
schickten schon mal gutes Essen und
halfen dort, wo es notwendig war. Meine
Brüder Rudolf und Werner wurden, wenn
sie aus der Schule kamen, bei der
Amlinger Mariann Base aufgenommen und
beköstigt und machten in der warmen
Stube ihr Schulaufgaben. Leo, der erst
drei Jahre alt war, nahm sie ganz zu sich.
Diese Frau Amlinger war voll des Lobes
über die Knaben. Sie seien brav und
folgten aufs Wort. Dies freute Mutter
sehr. Wir bekamen also gute Hilfe von
allen Seiten.
Nun waren wir zu sechst in der Familie
im Hause der Witwe Budinger. Das
Familienleben wickelte sich in einer
bescheidenen Stube ab. Dort wurde
gewaschen, gekocht, gegessen und
geschlafen. Rudolf allerdings
übernachtete mit dem 15 Jahre alten Sohn
Johann von Frau Budinger in einem
gemeinsamen Bett in einer abgetrennten
kleinen Schlafstube auf dem Dachboden. In
einem anderen Zimmer hatten wir den
kleinen Laden.
Oft geschah es, dass schon am frühen
Morgen, wenn wir aufstanden, vor der
Türe fein eingewickelt Brot lag. Wir
hatten nie erfahren, wer es hingelegt
hatte.
Aufregung kam nun vom Amtsgericht in
Zell. Man wollte behördlich den Kindern
einen Vormund vorschreiben. Dazu gab es
auch schon einige Vorschläge. Mutter
wehrte sich vehement mit Händen und
Füßen dagegen. Als dann verschiedene
maßgebliche Neefer Bürger, vor allem
der Ortsbürgermeister Nicholas Zimmer,
dem Gericht bescheinigten, dass doch
Mutter alles im Griff hätte und was für
eine tatkräftige und lebensnahe Frau sie
sei, sah dies auch das Gericht ein.
Mutter selbst wurde nun zum Vormund,
durch Bestallung vom 14. Dezember 1892,
erklärt. Das war dann auch erledigt.
Besonders zu Festtagen brachten gute
Leute schon mal eine Flasche Wein aus
ihren eigenen Weingärten. Dann stärkte
sich Mutter gerne mit dem edlen Tropfen
und ließ sich dazu ein Butterbrot
schmecken, dass sie leicht mit Salz
bestreut hatte. Auch wir Kinder,
besonders Rudolf und ich, durften am
Weinglas schon mal nippen, was wir sehr
gerne taten.
Zum Spielen mit Kindern war für mich
keine Zeit. Die Windeln für das
Brüderchen mussten gewaschen werden. Der
Dorfbrunnen war jedoch von der grimmigen
Kälte vereist. So ging ich an die
zugefrorene Mosel. Dort fand ich noch
eine kleine offene Stelle, die nur leicht
mit Eis überdeckt war. Ich erbrach diese
Eisdecke und wusch die Windeln im
eiskalten Moselwasser. Der Winter 1892/93
war sehr kalt. Ende April war der Fluss
noch zugefroren, und bis Ende Mai
schwammen Eisschollen auf der Mosel. Als
mich Tante Käthe, als sie aus dem
Fenster schaute sah, lief sie herbei und
sagte: „Mein Gott, nun kommt ihr
armen Leute aus dem heißen Südamerika
hier in die bittere Kälte! Es ist dein
Tod, Maria. So kannst du unmöglich
Windeln waschen. Von jetzt an kommst du
jeden Morgen in unser Haus, und ich
wasche für euch.“
So geschah es denn auch. Die besser
gestellten Leute im Ort hatten alle einen
Brunnen im Hause, den sie im Winter dick
mit Stroh umwickelten, damit er nicht
zufror. Die beiden Gemeindebrunnen
blieben bis zum ersten Tauwetter im April
zu. Dann machte man rund um die Brunnen
Feuer, damit sie auftauten.
Es kam für uns die erste Weihnacht in
Neef. Wir waren beeindruckt von der
Festlichkeit der Mette. Herr Pfarrer
Acker hatte wundervoll gepredigt vom
Frieden und der Nächstenliebe. Ja, wir
hatten die Nächstenliebe hautnah
erfahren. Ja, es gab die Leute, die den
Nächsten liebten wie sich selbst.
Und die Leute, die Mutter vor den Kopf
sagten, dass sie ihr Leid selbst
verschuldet habe, da sie den fremden
Beamten geheiratet hatte, die sollte es
offenbar auch geben. Auch sie gehörten
in Gottes bunten Blumenstrauß.
„Kommt “, sagte Mutter,
„jetzt schauen wir uns einmal unser
Jesuskindlein an.“ Wir gingen an die
Wiege des kleinen Franz Josef. Maria
küsste das liebe Kind und Rudolf
streichelte die Bäckchen des Kleinen. Da
lachte es wirklich und war doch noch
keine zwei Monate alt. Das war unser
schönstes Weihnachtsgeschenk.
Mutter war bekannt geworden, dass die
Geschäftsleute, die damals Vaters
Bergwerk billig erworben hatten,
unendlich reich geworden waren. Sie
schrieb zu Neujahr an Vaters Bruder in
Essen, Onkel Heinrich, dass er doch noch
einmal anfragen solle, ob sie nicht doch
bereit wären, eine finanzielle
Unterstützung zu geben. Das Bergwerk
hätte doch schließlich Vater von ihrem
Vermögen gekauft. Onkel Heinrich
besuchte uns kurze Zeit danach in unserer
armen Behausung. Er sagte Mutter, dass er
die Geschäftsleute besucht habe und bei
allen seinen Bemühungen nichts erreicht
hätte. Es handele sich um weltgewandte
und raffinierte Geschäftsleute, denen
nicht beizukommen sei.
Keine einzige Mark würden sie
herausrücken. Weitere Bemühungen seinen,
so Onkel Heinrichs Meinung, zwecklos.
Somit gab es aus dieser Richtung ein für
allemal keine Hoffnung zu schöpfen.
„Eher ist es möglich, dass ein
Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass
ein Reicher in den Himmel kommt“
– zitierte Mutter die Bibel. Und im
Blumenstrauß Gottes waren diese Reichen
die Mimosen, die schöner blühen als
alle anderen Blumen im Strauß, aber auch
am ehesten verwelken. Onkel Heinrich
hinterließ gute und aufmunternde Worte,
aber finanziell gab es keine Hilfe. Ja,
ja – er war ja auch reich geworden.
Durch Mutters robuste Gesundheit,
Geschick, Fleiß und Gottvertrauen
zählten wir schon bald nicht mehr zu den
aller ärmsten Bürgern in Neef. Aber
auch wir Kindern hatten Teil an diesem
Erfolg. Kaum war die Witterung gut, so
gingen Rudolf und ich in den schulfreien
Nachmittagen hoch auf den Berg und
sammelten Holz, das wir als Brennholz in
die Scheune schleiften und aufstapelten.
Nicht nur für den häuslichen Herd
benötigten wir das Holz, sondern auch
für das Brot backen in dem Backes, den
der Nicholas Zimmer in der Nachbarschaft
hatte. Er stand uns ab und zu zur
Verfügung. Den gesunden Feldsalat
sammelten wir in den Weinbergen auf. In
den Hecken fanden wir Futter für Tante
Ev’s Kühe, was diese immer mit
einem Kessel voller Milch entlohnte. Es
gab nur wenige Wiesen im Mühlbach
entlang, so dass mit Heckenfutter und
Laub ausgeholfen werden musste. Rudolf
ging auch schon mal angeln, und tat es
mit viel Geschick und Erfolg. Die freie
Natur bescherte uns weiter Nüsse,
Löwenzahn, Laiensalat, Bärlauch,
Buchecker, Eicheln, Hagebutten, Pilze und
vieles andere mehr. Für das Sammeln von
Tee’s und Kräutern zeigte ich mich
gerne zuständig und hatte auch schnell
Kenntnisse auf diesem Gebiet. So konnte
ich den Kunden im Laden Empfehlungen
geben.
Mutter hatte sich eine Nähmaschine
gekauft und einfache Sachen, wie
Schürzen, Kopf-, Hand- und
Taschentücher genäht. Dieses
zusätzliche Produkt war recht gut zu
verkaufen und Mutter nähte oft bis tief
in die Nacht hinein.
Die Gemeinde hatte uns kostenlos eine
Loh-Hecke zur Verfügung gestellt. Dort
hätten wir im Frühjahr Lohe schälen
können. Die Einnahmen aus dem Verkauf
der Lohe waren für manchen Neefer Winzer,
auch wenn sie sehr spärlich waren,
hochwillkommen. Aber wir hatten nunmehr
aus dem Geschäft ein Einkommen, dass uns
zufrieden stellte. Zudem war das Lohe-Schälen
eine harte und robuste Männerarbeit, und
dazu waren meine Brüder noch nicht alt
genug. Mutter lehnte das Angebot dankend
ab.
Apropos Lohe - dazu gibt es eine recht
lustige Geschichte zu berichten: Im
Dorfdistrikt "Neugarten"
lagerten auf einem freien Platz
haufenweise die Lohe. Gerne versammelten
sich am Abend dort die Männer. Sie
saßen dann auf diesen gebündelten
Eichenrinden, tranken ihren "Fluppes"
(einfacher Hauswein), hielten
Schwätzchen und rauchten Stumpen (selbstgedrehte
Zigarren aus billigem Tabak-Kraut -
zumeist eigene Ernte). Als Rudolf einmal
dort vorbei kam, wurde er gleich
aufgehalten, und man bat ihn, aus seiner
Zeit in Argentinien zu erzählen, was er
auch gerne tat. Als Anerkennung für
seinen geselligen Beitrag bot man ihm den
"Fluppes-Krug" an, den er auch
gerne ansetzte. Noch größer wurde sein
Selbstwertgefühl, als er nun auch noch
an einem Stumpen ziehen konnte.
Fluppestrinkend, von Argentinien
berichtend und stumpenrauchend verweilte
er noch eine recht lange Zeit bei den
Männern - bis ihm plötzlich schlecht
wurde und er so schnell er konnte nach
Hause lief. Entsetzt sah nun die Mutter
ihren blassen und sich übergebenden Sohn.
"Um Himmels Willen! Was hast Du? Was
ist geschehen? - Hauch mich einmal an!"
Rudolf erzähle reumutig was geschehen
war. Er musste sofort ins Bett gehen.
Zuvor bekam er noch eine Tracht Prügel.
Es war übrigens die einzige in seinem
Leben, die er von seiner Mutter bekam.
Onkel Heinrich hatte nun Mutter
mitgeteilt, dass sein Eisenwarengeschäft
in Essen weiterhin so gut gedeihe, dass
er nun Hilfe brauche. So wolle er gerne
eins oder zwei der Kinder seines Bruders
in seine Familie aufnehmen.
Sie sollten es so gut haben, wie seine
eigenen Kinder, und er wolle sie auch so
ausbilden lassen, dass sie später in
seinem Geschäft mitarbeiten könnten.
Wir Kinder hatten nun schon mehrmals
mitbekommen, dass man uns in eine fremde
Familie aufnehmen wollte. Stets lehnte
Mutter solche Ansinnen spontan ab. Als
Rudolf und ich einmal wieder im Wald
waren und Holz sammelten, berieten wir
bei einer Vesper, was wir dagegen tun
könnten. „Vielleicht sollten wir in
die einsame und verlassene Einsiedelei am
Nordhang des Hochkessels ziehen, um dort
noch intensiver beten zu können als
bisher“ - so meinte es Rudolf. Ich
fand seinen Vorschlag gut und fügte
hinzu, dass uns zudem dort die Leute, die
uns adoptieren wollen, nicht finden, oder
uns vergessen würden. Wir wären ja dann
weit genug entfernt. Keiner sollte wissen,
außer Mutter natürlich, wo wir wären.
Später gehörte auch noch Werner zum
„Holztrupp“. Wir waren zusammen
ein Herz und eine Seele - waren froh und
ernst zugleich.
Einmal, als wir Holz im Wald gesammelt
hatten, erschien plötzlich der
Waldaufseher und brüllte uns an: "Was
ihr da macht ist verboten! Das muss vom
Förster genehmigt sein! Und einen
solchen Genehmigungsschein habt ihr nicht!
Das Holz bleibt hier liegen und nun seht
zu, dass ihr nach Hause kommt!" Wir
waren geschockt und fingen an zu weinen.
Dann kam die Frau des Aufsehers hinzu.
Sie redete auf ihren Mann lange und
beschwichtigend ein, bis dieser
letztendlich einverstanden war, dass wir
das Holz, so wie wir es gesammelt hatten,
nach Hause schleifen konnten.
Als Rudolf 9, Werner gerade einmal 8
und Leo 4 Jahre alt waren, bot ihnen der
"Lutsch-Lons" (er lutschte
immer Kautabak) eine Arbeit an. Er hatte
gehacktes Holz auf den Speicher zu
befördern. Darauf ging man ein und
hofften, das dürftige Taschengeld etwas
auffrischen zu können. Rudolf war recht
kräftig für sein Alter. Er ging auf den
Speicher, ließ über einen sogenannten
Wirbel das Seil mit einem Korb hinab,
Werner und Leo füllten ihn und Rudolf
zog hoch. Das funktionierte recht gut und
füllte einen ganzen Nachmittag aus. Das
gesamte Holz lag auf dem Speicher, und
nun wartete man schon etwas gespannt auf
die Entlohnung. Diese fiel allerdings
recht dürftig aus: Jeder bekam ein
Butterbrot. Mutter Barbara war darüber
entrüstet! "Für den macht nie mehr
etwas. Für einen solchen Bettellohn seid
ihr mir zu schade!" - war ihre
spontane Äußerung.
Im Steinbruch im Bereich des
Frauenberges nisteten stets "Erkerte",
so nannte man die Sperber. Rudolf war
bekannt dafür, dass er ein richtiger
Naturbursche war. So kannte er in diesem
Felsen die Brutstätten solcher
Raubvögel. Der jagdbesessenen Franz
Kreuter sprach Rudolf an, ob er ihm einen
jungen Sperber besorgen könne. Für
Rudolf war das kein Problem. Er stieg in
den Felsen ein und konnte aus einem Horst
tatsächlich einen jungen "Erkert"
an sich nehmen und steckte ihn in einen
Beutel. Das war nicht ganz ungefährlich,
denn die Vogeleltern ließen diesen Raub
nicht so ohne weiteres zu. Zudem musste
man schwindelfrei sein und sicher in der
Felswand greifen können. Schließlich
konnte Rudolf den jungen Sperber dem
Franz Kreuter übergeben. Dafür bekam
Rudolf eine Mark. Nicht viel - aber auch
nicht zu wenig. Als Rudolfs Mutter jedoch
von diesem Händel erfuhr, bekam er
ordentliche Schimpfe. Hatte doch Rudolf
für eine Mark sein Leben riskiert! Er
musste die Mark seiner Mutter abgeben und
versprechen, nie wieder so etwas hinter
ihrem Rücken zu tun.
Allgemein herrschte in Neef eine
große Armut. Es gab Familien, die nur
ein Fuder Wein ernteten, und das dann
noch in schlechter Lage. Dieses
verkauften sie gelegentlich für einige
100 Mark, wenn die Weinhändler endlich
einmal kamen. Der kleine Erlös musste
dann den Jahresbedarf einer Familie für
Kleider, Hausbedarf, Gartendünger,
Weinbergsgeräte und anderes mehr decken.
Man sah Kinder und auch Erwachsene mit
Löchern in Schuh und Strümpfen. Reich
nannte man den Essigfabrikanten Karl
Kaufmann, zwei Gastwirte und noch sechs
bis zehn Winzerfamilien mit großem
Weinbergsbesitz. Alle anderen mussten
sich kümmerlich durchschlagen, zumeist
noch mit einem Haufen Kindern.
Nachbar Karl Kaspar Kreuter war Winzer,
Schnapsbrenner, Metzger und
Hausschlächter. Außerdem unterhielt er
den Gemeindestier. Mehrmals kam es vor,
dass dieser aus dem Stall ausriss. Dann
ging der Schrei rundum "der Stier
ist los! - der Stier ist los!" Alle
Leute stürzten ins Haus oder begaben
sich sonstwie in Sicherheit. Hatte sich
der Stier ausgetobt, dann fingen ihn
schließlich beherzte Männer wieder ein
und brachten ihn in den Stall.
Karl Kaspar musste oft für seine
Leistungen lange auf den Geldeingang
warten. Er hatte sogar schon Ausfälle
hinnehmen müssen. Da ihm ein Neefer
Bürger eine offene Rechnung in barem
Geld nicht begleichen konnte, gab er
einen jungen Stier in Zahlung. Dieser
sollte umgehend geschlachtet werden. Kaum
hatte man das Tier in das Schlachthaus
gebracht, wurde es wild und drückte den
Karl Kaspar so an die Wand, dass er
fortan ein Herzleiden hatte und später
sogar daran starb.
Die allgemeine Armut in Neef stieg.
Die Bahn-Trasse war fertig gestellt. Kein
Bauarbeiter wurde mehr benötigt.
Ansonsten gab es nur noch Beschäftigung
in der Essigfabrik. Wohl dem, der dort
arbeitete war. Es gab Familien, die nur
ein Fuder Wein ernteten, und das dann
noch in schlechter Lage. Dieses
verkauften sie gelegentlich für einige
100 Mark, wenn die Weinhändler endlich
einmal kamen. Dieser kleine Erlös musste
dann den Jahresbedarf einer Familie für
Kleider, Hausbedarf, Gartendünger,
Weinbergsgeräte und anderes mehr decken.
Man sah Kinder und auch Erwachsene mit
Löchern in Schuh und Strümpfen. Reich
nannte man den Essigfabrikanten Karl
Kaufmann, zwei Gastwirte und noch sechs
bis zehn Winzerfamilien mit großem
Weinbergsbesitz. Alle anderen mussten
sich kümmerlich durchschlagen, zumeist
noch mit einem Haufen Kindern.
Einen Metzger gab es in Neef noch
nicht. Die Bestgestellten des Ortes
schlachteten im Winter ein Rind oder eine
Kuh und zusätzlich noch ein Schwein.
Diese Leute hatten einen großen
Rauchfang, worin das Fleisch geräuchert
wurde. Im Laufe des Jahres wurde dann das
Fleisch nach und nach abgeschnippelt und
zu Mittag aufgezehrt. Dazu gab es
meistens einen Krug „Stipp“,
der auch „Fluppes“ genannt
wurde. Dies war ein alkoholschwacher
Hauswein, der aus aufgeweichten
Tresterresten gekeltert wurde. Des Abends
gab es zumeist Kartoffelsalat oder nur
Kartoffeln mit Speckgrieben und wieder
diesen „Stipp“ dazu. Die armen
Leute aßen zumeist Kohl, Kartoffeln mit
Zwiebelsoße, Salate aus dem Garten.
Billigen Pansen und einfache Blut- und
Leberwurst kauften sie beim jüdischen
Metzger Julius Kahn in Bullay.
Wenn die reichen Leute geschlachtet
hatten, vergaben sie den Armen die
Wurstsuppe und die Schmalzgrieben.
Als uns Tante Ev im Frühjahr 1893
einen Kinderwagen überließ, war das ein
besonderes Ereignis. Wenn ich nun mit dem
kleinen Brüderchen auf Sparzierfahrt
ging, genoss er dies in vollen Zügen. Er
strahlte und strampelte voller Vergnügen.
Da blieben auch schon mal die Leute
stehen und schwatzten mit mir. Oft
wollten sie dann auch von meinen
Erlebnissen in Argentinien erzählt haben,
und immer bewunderten sie unsere tapfere
Mutter.
Der Winter 1893/94 war sehr hart.
Einmal wurden wir mitten in der Nacht vom
Feuerwehrhorn und läutenden Glocken
geweckt. Das Eis auf der Mosel hatte sich
gelöst. Jeder der nur konnte lief zur
Mosel und schaute sich dieses Ereignis,
das sich zu einer Katastrophe entwickeln
konnte, an. Es krachte und rumorte. Dicke
Eisschollen schoben sich aufeinander. Die
Gefahr bestand, dass das Eis in der
Krümmung am Frauenberg staute und sich
ein See bildete. Dies hätte ein großes
Hochwasser zur Folge gehabt. Deshalb
standen alle erwachsenen Leute parat, um
erforderlichenfalls zu helfen. Wir Kinder,
insbesonders Leo, Rudolf und ich, waren
beeindruckt von diesem Naturereignis. War
es doch noch gar nicht so lange her, dass
wir in unserem Umfeld nur brühwarme
Sümpfe, Moskitos, Krokodile und
Schlangen kannten.
Im Jahre 1894 konnten wir endlich ein
geeignetes Haus beziehen, das unseren
Urgroßeltern als Schule gedient hatte.
Mutter wusste noch zu erzählen, dass der
damalige Lehrer gleichzeitig Schuster war.
Die Kinder der armen Leute unterrichtete
er am Sonntag. Werktags hatten sie für
die Familie Arbeiten zu verrichten. Die
Kinder der reichen Leute hatten während
der Woche Unterricht, die brauchten ja
nicht zu arbeiten. Ansonsten hätte er
noch Dienste in der Matthiaskirche
verrichtet. Er sei nicht der besonders
gute Lehrer gewesen. Wenn er viel zu tun
hatte, schickte er einfach die Kinder zum
Spielen auf die Straße.
Das Haus hatte ein auffallend großes
Eckfenster und lag in der Nachbarschaft
unserer bisherigen Unterkunft und hatte
im Erdgeschoss ein Zimmer, das 45 qm
groß war. Dieser Raum diente uns als
Laden. Im Obergeschoss und im Dachraum
wohnten und schliefen wir. Das Plumpsklo
stand draußen in einer Ecke zum
Nachbarhaus hin.
Von großem Vorteil war es auch, dass
uns ein Kelterhaus zur Verfügung stand.
Dies nutzten wir allerdings nicht als
solches, sondern wir lagerten in ihm
unser Brennholz und konnten auch Leergut
und Vorräte dort abstellen. Zudem fanden
dort unsere Karre und ein
Leiterwägelchen ihren Platz. Neben dem
Kelterhaus war uns ein kleiner Garten von
Nutzen.
Die Leute, die dieses Haus bewohnt
hatten, zogen fort. Der Hauseigentümer,
ein alter Junggeselle, wohnte mit seiner
ledigen Schwester nun in Zell. Die Miete
war nicht teuer. Es bestand die
Möglichkeit, das Haus zu kaufen, was
Mutter auch vorhatte - „wenn die
Kinder aus der Schule entlassen
sind“. In diesem Anwesen blühte
unser Gemischtwarengeschäft so richtig
auf.
Von großen Nutzen war uns die Hilfe
von Josef Nelius. Er gab meiner Mutter
Geld, damit sie sich einen Sack Mehl
kaufen konnte. Mutter stellte den Sack
auf einen Küchenstuhl und verpackte die
Hälfte des Mehl pfundweise in Tüten ab.
Von der anderen Hälfte backte sie Brot.
Der Verkauf von Brot und Mehl brachten
ihr so viel Gewinn, dass sie dem Josef
Nelius das Geld schon umgehend wieder
zurück zahlen konnte. Und dieser gute
Mann gab Mutter auch weiterhin schon mal
einen Kredit, wenn dies nötig war. Josef
Nelius war nicht unbedingt ein reicher
Mann. Er lebte in bescheidenen
Verhältnissen.
Das Geld lieh er Mutter aus, weil er
ein gläubiger Christ war und weil er
helfen wollte. Nie hatte bei ihm der
Profit eine Bedeutung.
Beim jüdischen Metzger Julius Kahn
aus Bullay kaufte Mutter
Schweinefüßchen und Kalbsköpfe. Daraus
machte sie Sülze. Das konnte sie
preiswert und doch mit gutem Profit
verkaufen. Auch Ziegenfleisch war beim
Herrn Kahn billig und kostete 40 Pfennig
das Pfund. Rindfleisch kostete 60 Pfennig.
Metzger Kahn war sehr gut zu uns. Er gab
uns stets Sonderpreise, da er wusste, wie
gut er uns damit helfen konnte. Er machte
sogar Vorschläge, wie hoch der
Wiederverkaufpreis anzusetzen war.
Außerdem kauften wir auch noch
Fleischwaren, wie kleine Schinken, Speck
und Würste von Richard Ebbefeld aus
Koblenz. Diese Artikel gingen reißend
weg.
Nun verkauften wir auch Stoffe. Diese
bezog Mutter vom Großhändler Klischan
& Co. aus Köln. Jeden Freitag kam
eine Sendung Fisch von der Fa. Heinemann
& Udo aus Bremerhaven. Dazu gehörten
neben Stockfischen und Bücklinge auch
ein Zentner Seefische. Wenn es schon mal
vorkam, dass nicht alle Fische verkauft
worden waren, wurden die übrigen Fische
gebacken, in eine Essigbrühe gelegt und
dann verkauft. Diese Arbeit übernahm ich
und machte das so perfekt, dass die Leute
schon auf diese eingelegten sauren Fische
warteten. Von der Firma Fischer &
Pies aus Cochem erhielten wir die
Kolonialwaren zumeist in Zwei-Zentner-Säcken.
Bei dieser Menge gab es einen satten
Rabatt. Die Fa. Maret aus Koblenz
lieferte Seife und Seifenpulver, die Fa.
Heinemann & Udo. Sämereien aus
Hameln, Tabak und Zigarren aus Zell und
Brodenbach, Kautabak und Rolltabak aus
Wittlich, Drogeriewaren aus Aachen –
es gab kaum etwas, was bei uns nicht zu
kaufen war. Mutter schwätzte gerne mit
den Leuten. Sie lachte mit ihnen und nahm
auch an ihren Schicksalen teil. Auch ich
war voll im Geschäft integriert. Gerne
war ich zuständig für den Drogenschrank
und gab sogar selbständig die
Bestellungen auf. Das Geschäft lief und
lief. Die Lieferanten arbeiteten gerne
mit Mutter zusammen, da sie immer sofort
zahlte.
Wir konnten uns nunmehr schon gutes
Rinder- oder Schweine-Fleisch an
Feiertagen gönnen. Im Frühjahr kauften
wir für 20 Pfennig einen halben Eimer
voll mit kleinen Fischen bei einem
Bremmer Fischer. Die Fische wurden
gesäubert und dann in Rüböl gebacken.
Dazu gab es Gemüse aus dem gepachteten
Garten.
Inzwischen konnte sich auch Franz
Josef in der Familie nützlich machen.
Ein besonderes Erlebnis war es für ihn
einmal, dass er einen ganzen Eimer voll
Laien-Salat in den Felsen vom Frauenberg
gesammelt hatte. Als dies der reiche
Essigfabrikant Carl Kaufmann sah, konnte
Franz Josef mit ihm ein Geschäft machen
und erhielt ganze zwei Mark für diese
Ernte. Das war übermäßig viel. Was
hätte man dafür bei Mutter alles kaufen
können! Carl Kaufmann war ein guter
reicher Mann. Er half den armen Winzern
und kaufte ihnen den Wein auch dann ab,
wenn dieser „umgekippt“ war,
wenn ihn z. B. die Essigfliege
ungenießbar gemacht hatte. Daraus machte
er einen schmackhaften Weinessig. Er
beschäftigte zeitweise bis zu 30 Leute
und gab vielen Familien im Ort eine
Existenzgrundlage.
Schnell stieg Franz Josef dann wieder
in den Felsen ein und hatte keine Mühe,
einen weiteren Eimer voll von diesem
köstlichen Salat zu pflücken. Josef
kannte die Stellen, wo er wuchs. Das
behielt er aber als strenges Geheimnis.
Ja, der Franz Josef war schon als Kind
sehr geschäftstüchtig. Der Jude Julius
Kahn, der ja Mutter mir Metzgereiartikeln
belieferte, war sein spezieller Freund.
Herr Kahn war ein ganz frommer Jude. Wenn
Sabbat war, richtete er sich streng an
die Vorschriften seines Glaubens. Dann
durfte er zum Beispiel kein Feuer
anzünden, keine Arbeiten verrichten, zu
denen er irgendein Werkzeug benötigte.
Es war außerdem verboten, am Sabbat
etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Und um
das Nötigste zu verrichten, fuhr Franz
Josef mit der Bahn nach Bullay und stand
in der jüdischen Familie zu Diensten. Er
wurde schon fast fürstlich belohnt,
wovon Mutter natürlich immer
partizipierte. Der Jude Kahn war wirklich
ein guter Mensch. So kaufte er den Leuten
schon mal für gutes Geld eine alte Kuh
zur Schlachtung ab, oder gab einen Tipp,
wo man ein gute junge Kuh günstig kaufen
kann.
Es gab also doch auch gute reiche
Leute. Dies waren der Carl Kaufmann und
der Julius Kahn. Sie waren in dem
Blumenstrauß Gottes die prächtigen
Rosen.
„Wir“, so meinte Mutter,
„sind die Margeriten und auch die
Butterblumen. Diese sind im Strauß
unverzichtbar und machen die Fülle aus.
Und das sind wir.“ Mutter lachte
dabei zufrieden. „Damit kann ich gut
leben!“ Finanziell ging es uns immer
besser. Ja, hier gehörten wir hin! In
Argentinien waren wir fehl am Platz!
„Da hatte uns der Komet doch den
richtigen Weg gezeigt“ meinte Mutter
vergnügt und fügte hinzu, dass es doch
in vielen Nächten Kometen zu beobachten
gäbe. „In der Not, als wir den
Kometen in der argentinischen Wildnis
beobachteten, klammerten wir uns wirklich
an jeden Strohhalm, um Hoffnung schöpfen
zu können.“.Werner war mit 14
Jahren bei einem Schneider in Brodenbach
in der Lehre. Er hatte einen Freund, der
stets unter einem eitrigen Hautausschlag
(Schwäre) litt. Diese Krankheit trat
damals recht häufig auf. In der
Pfarrkirche zu Ernst (bei Cochem)
verehrte man den hl. Jobs. Und dieser
Heilige, im Volksmund war er der "Schwäre-Jobs",
sollte eine solche Krankheit durch
Fürsprache bei Gott heilen können. So
machten die Beiden eine Wallfahrt nach
Ernst. Nach frommen Gebeten begab man
sich wieder auf die Rückreise. Zu Fuß
ging es nach Cochem, und von dort aus per
Bahn nach Löf, wo Werners Freund zu
Hause war. Man trank im elterlichen
Weinkeller noch einige Gläschen Wein,
bevor Werner sich zur Fähre begab um
nach Brodenbach überzusetzen. Es war
jedoch schon sehr spät, und kein
Fährmann rührte sich auf die steten
Rufe "Hohl über". Schließlich
legte er sich in das Grummet (frisches
gemähtes Gras) und fiel in einen tiefen
Schlaf. So lag er bis zum Morgen im
nassen und kühlen Gras. Dies machte ihn
lungenkrank für sein gesamtes restliche
Leben.
Es war schon eine kleine
Brandkatastrophe, als am 16. März 1903
im Unterdorf drei Häuser abbrannten.
Tief in der Nacht hörten wir das
Brandhorn, und wir alle eilten aus
unseren Betten. Draußen erkannten wir
schon die bizarre Helligkeit, welche die
Brandstelle unfehlbar auffinden ließ.
Auch Mutters Elternhaus brannte. Mutter
beobachtete dies erst mit starren Blicken.
Schließlich fing sie an zu weinen. Dann
hörte ich sie flüstern; "Aus -
vorbei". Nun gab es dieses Relikt,
das sie an eine schöne Kindheit, an die
fröhliche Zeit in der Gastwirtschaft und
an den guten Vater erinnerte, nicht mehr.
Das Haus brannte bis auf eine traurige
Ruine restlos nieder. Dies war für
Mutter der entgültiger Schlussstrich
unter die Vergangenheit.
Noch bevor der schreckliche Weltkrieg
begann, kaufte Mutter 1913 in der
Nachbarschaft ein Grundstück, auf dem
schon eine gemauerte Scheune stand.
Dieser setzte sie einen Neubau vor. Es
war ein prächtiges Fachwerkhaus. Wir
hatten auch einen schönen Garten dabei,
in dem wir allerhand nützliches Gemüse
und kostbare Salate anpflanzten. In der
alten Scheune hatten wir eine Ziege und
allerlei Geflügel untergebracht. Vor
allen Dingen hatten wir nunmehr einen
wunderschönen Laden und mehr Zimmer als
zuvor. Mutter benötigte zu diesem
Unterfangen einen Kredit bei dem
örtlichen Darlehnskassen-Verein, der ihr
bedenkenlos und umgehend bewilligt wurde,
da sie eine ordentliche Eigenleistung in
barem Geld aufweisen konnte und zudem ja
als sehr fleißig und genügsam überall
bekannt war. Ja, die Zeiten hatten sich
geändert! Die Barbara Blümling war
kreditwürdig!
Eigentlich lief nun unser Alltagsleben
seinen normalen und geregelten Gang. Ich
war Novizin im Kloster, Rudolf hatte das
Bäckerhandwerk erlernt, Werner war ein
tüchtiger Schneider, Leo ein fleißger
Schreiner und Franz Josef schickte sich
an, ein guter Kaufmann zu werden. Er
vertrat mich im Laden wie es besser gar
nicht sein konnte und hatte durch seine
lustige Art einen sehr guten Kontakt zu
Kundschaft.
Dann kamen 1914 die Einberufungen zum
Krieg. Mutter war nun bald schon 60 Jahre
alt. Mit viel Tränen verabschiedete sie
nacheinander drei Söhne - Rudolf, Leo
und Josef. Werner konnte nicht zum
Militär gemustert werden. Sein
Lungenleiden ließ es nicht zu. Seine
Krankheit wurde stetig heftiger. In der
Lungenheilstätte in Ruppertsheim im
Taunus wurde ihm schließlich gesagt,
dass er unheilbar krank wäre. Mit diesem
Ergebnis kam er nach Hause. In tiefer
Frömmigkeit bereitete nun Mutter ihren
Sohn, der noch so gerne gelebt hätte,
auf den Tod vor. Nur der Ewigkeitsgedanke
konnte Werner in seiner Situation hoch
halten. Für Mutter kam noch hinzu, dass
die anderen drei Söhne in ständiger
Lebensgefahr an der Front waren und dies
stetig in Briefen mitteilten.
Am Ostermorgen 1917 starb Werner
während des Hochamtes. Obwohl wir auf
seinen Tod vorbereitet waren, hatten wir
alle eine tiefe Trauer. Bei der
Beerdigung gingen Mutter und ich ganz
alleine von der großen Verwandtschaft
hinter dem Sarg. Danach kamen die
Angehörigen und dann das ganze Dorf -
wer nur eben abkommen konnte. Werner war
jedermanns Liebling gewesen. Leider
konnten ihn seine Brüder auf dem letzten
Weg nicht begleiten. Sie waren alle fern
weg im Krieg. Man konnte nur hoffen, dass
sie die Todesnachricht erreicht hatte,
und sie ihrem Bruder in Gedanken und im
Gebet gedenken konnten.
Als nach dem verlorenen Krieg Mutters
drei Söhne wohlbehalten wiederkamen,
atmete Mutter wieder auf.
Im Jahre 1927 erwarb Franz Josef ein
noch schöneres und größeres Haus. Es
war das vormalige Schulhaus. Viele Räume
standen uns zur Verfügung. Im
Erdgeschoss war nicht nur Platz für
einen geräumigen Laden, auch ein
Lagerraum für Warenvorräte, eine große
Küche, einen Waschraum und sogar einen
Büroraum konnten wir dort einrichten. Im
Obergeschoss und sogar auf dem Speicher
gab es für alle Bedürfnisse einer
großen Familie Platz über Platz.
Zu alledem gab es auch noch einen
großen Gewölbekeller. Somit war für
Franz Josef die Gelegenheit gegeben, mit
einem Weingeschäft zu beginnen. Die
Weinberge dazu hatte seine Frau Sophie in
die Ehe eingebracht.
Mutter wählte sich ein schönes
Zimmer im Haus aus. Sie war glücklich,
im Familienleben von Franz Josef und
seiner guten Sophie eingebunden zu sein,
was durch die Geburt von zwei Kindern
bereichert wurde.
|
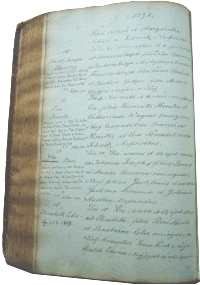 |
| Taufbuch von
Neef: Am 2.11.1892 wurde Franz
Josef geboren |
| |
| |
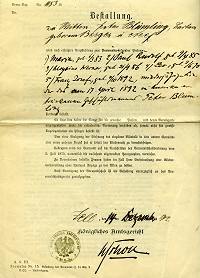 |
| Vormundschaftserklärung |
| |
| |
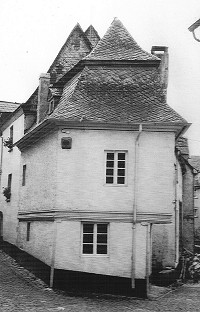 |
| Hier in dem
ersten Schulhaus für Neef begann
der Aufschwung des
Gemichtwarenladens |
| |
| |
 |
| Das vormalige
Kelterhaus war nützlich als
Schuppen |
| |
| |
 |
| Lohschälen war
eine harte Arbeit für robuste
Männer |
| |
| |
 |
| Heinrich
Blümling, der erfolgreiche
Geschäftsmann in Essen und
Bruder vom Peter Blümling |
| |
| |
 |
Eisgang 1894 -
Schiffe, die nicht zeitig in
einen sicheren Hafen gebracht
wurden, waren der Naturgewalt
ausgesetzt.
Foto: Rhein-Museum, Koblenz |
| |
| |
 |
| Franz Kreuter |
| |
| |
 |
| Karl Kaspar
Kreuter |
| |
| |
 |
Job, eine
biblische Figur aus dem alten
Testament, gilt als ein Vorbild
der Frömmigkeit, der Geduld und
Gottergebenheit.
Die Figur "Job im Leid"
steht in der Ernster Pfarrkirche
und ist mit Schwären bedeckt. |
| |
| |
 |
| Werner |
| |
| |
 |
| Franz Josef als
Soldat im Ersten Weltkrieg |
| |
| |
 |
| Dieses
Fachwerkhaus wurde von Barbara
gekauft. Es war ihr erstes
stolzes Eigentum |
| |
| |
 |
| Sohn Franz Josef
erwarb dieses vormalige dritte
Schulhaus |
| |
| |
|
| |
|
 15.
Ein folgenschwerer Entschluss 15.
Ein folgenschwerer Entschluss Im
Jahr 1896 ging ich mit 13 Jahren zur hl.
Kommunion. Dieses Ereignis war für mich
ein Einschnitt und zugleich ein Abschnitt
in meinem Innenleben. Auf der
Kommunionfeier lobte mich Mutter und
ließ alle Gäste wissen, wie tüchtig
ich sei und wie ich der Familie nutze.
Sie gab fernerhin bekannt, dass ich
später, wenn ich einmal aus der Schule
entlassen werde, gerne das Geschäft in
eigener Regie führen könne. Ich hätte
dann schon früh eine gesicherte Existenz.
Bei dieser Lobeshymne wurde ich still,
denn ich hatte beschlossen, in ein
Kloster einzutreten. Eigentlich hatte ich
schon mit fünf Jahren, als ich zum
ersten Mal eine Ordensfrau sah, das
Gelöbnis gemacht, Ordensschwester zu
werden. Es war noch in Elberfeld, als
Vater den Entschluss fasste, nach
Argentinien auszuwandern. Ich sah, wie
schwer dieser Entschluss von Mutter
verkraftet wurde und konnte mir von nun
an das Erwachsenenleben nur im Dienste
Gottes in einem Kloster vorstellen. Die
dann folgenden Ereignisse bestätigten
eher meine Entscheidung, als dass sie zu
einer Änderung geführt hätten. Nun
musste ich Mutter meinen Entschluss
bekennen. Mutter tat nicht so bestürzt,
wie ich es befürchtete. Ich hatte
schließlich einen Vertrag mit Gott
gemacht.
Ja, es kam so vieles anders als Mutter
es gehofft hatte. Im Monat August erlitt
ich einen Nervenzusammenbruch, dessen
Auswirkung sich im Laufe des weiteren
Jahres 1896 verschlimmerte. Im Februar
des folgenden Jahres musste man mich
sogar in eine Nervenheilanstalt bringen.
Es war ein furchtbares Erlebnis für die
ganze Familie. Ich kam in das
Fachkrankenhaus für Psychiatrie und
Psychotherapie, das sich in Dernbach im
Westerwald befand und von den Nonnen der
„Arme Dienstmägde Jesu
Christi“ geführt wurde.
Einen Schwerpunkt legten die
Schwestern auch auf Erziehung und Bildung.
So gab es für junge Menschen, die
zumeist Waisen waren oder aus gestörten
Familienverhältnissen kamen, kostenlosen
Schulunterricht. Obwohl ich bereits 14
Jahre alt war, durfte ich an diesem
teilnehmen. Das war ein großer Vorteil
für mein späteres Leben. Ich war mit
viel Eifer am Unterricht beteiligt. Mein
Gesundheitszustand verbesserte sich so,
dass ich 1898 wieder nach Hause durfte.
Als mich die Schulschwester Antonelle
verabschiedete sagte diese zu mir in
einem schon feierlichen Ton: „Maria,
ich meine bestimmt, mit dir hat der liebe
Gott Besonderes vor. Gehe in die Kapelle
und sage Gott, er möge dir die
Gesundheit geben und dir den richtigen
Weg zeigen.“ Ich betete in der
Kapelle, erneuerte mein Versprechen. Es
war mir sehr wohl dabei und verspürte
eine große innerliche Ruhe. Ich wollte
eine fromme „Arme Dienstmagd Jesu
Christi“ werden.
Da ich in Dernbach auch eine
Ausbildung in der Küche absolviert hatte,
ging ich zwei Jahre in einen vornehmen
Haushalt in Frankfurt. Dort stellte ich
meine Kenntnisse in der Küche unter
Beweis und lernte auch noch hinzu. So
konnte ich meine Kochkünste in Neef
unter die Leute bringen und kochte auf
Hochzeiten und Taufen schon mal für 60
– 80 Leute das Festessen. Alle waren
von meinen Zubereitungen begeistert.
Mutter veranlasste nun, dass ich auch
noch in einem Kolonialwarengeschäft
ausgebildet wurde, was auch sehr
erfolgreich verlief. Danach war ich voll
an der Seite von Mutter im elterlichen
Geschäft tätig. Die Zusammenarbeit
verlief sehr harmonisch und war
erfolgreich. Oft lobte mich Mutter. Sie
wollte mich sicherlich beweisen lassen,
dass ich auch im weltlichen Leben
brauchbar bin.
Als ich 25 Jahre alt war, sagte ich
Mutter, dass ich schon zwei
Heiratsanträge ausgeschlagen und an
weltlichen Vergnügungen keinerlei
Interesse hätte. „Jetzt möchte ich
mein Gelübde einhalten und ins Kloster
gehen“. Da sagte die heroische
Mutter: „Deinem Glück will ich
nicht entgegenstehen. Wenn du meinst, im
Kloster sei deine Heimat, dann melde dich
in Dernbach an.“ Das war im
Frühjahr 1908. Nicht nur mein Bruder
Werner, auch viele Leute aus dem Ort
sagten: „Wie kannst du deiner Mutter
so etwas antun? Bleib doch bei ihr! Du
hast kein Herz.“ Dies alles machte
mir sehr zu schaffen – änderte aber
nicht meinen Entschluss. Ich folgte
bedingungslos einer inneren Stimme.
Als ich noch Novizin im Kloster in
Dernbach war, kam Bruder Werner krank aus
dem Krieg nach Hause und hatte den Tod
vor Augen. Ich wurde von der Oberin frei
gestellt und half meiner Mutter, wo es
nur ging. Ganz besonders pflegte ich
meinen Bruder bis er am 8.4.1917 im
blühenden Alter von 30 Jahren verstarb.
Der Abschied von ihm war für uns alle
ein großer Schicksalsschlag.
Am 9. Mai 1922 legte ich mein Gelübde
ab. An der Feierlichkeit nahmen viele
Verwandte aus Neef, Senheim und Essen
teil. Mutter sah, wie glücklich ich war.
Sie war selbst auch von Zufriedenheit
erfüllt. Ich erhielt den Namen Verenosa
(verus – die aus dem wirklichen
Leben kommende).
Ich war nun maßgeblich in der
Krankenpflege tätig – sowohl in
Krankenhäusern, als auch bei Patienten
zu Hause. Diese Aufgabe verrichtete ich
mit Leib und Seele. Ich erntete viel Lob
und Anerkennung. Nie mehr litt ich unter
diesen hässlichen Kopfschmerzen. Später,
als ich älter wurde, übernahm ich im St.
Josefhaus, wo die älteren Schwestern
wohnten, die Teeküche. Ich hatte einen
eigenen Raum zur Verfügung, in dem ich
Küchenkräuter und Tee’s trocknete
und zubereitete. Diese hatte ich in der
Regel im Wald und auf der Wiese selbst
gesammelt. Meine Arbeiten machten mir
sehr viel Spaß, besonders dann, wenn
mich die Kinder meiner Geschwister
besuchten. Ich ging dann mit ihnen
sammeln und konnte sie auch belehren.
Schwester Verenosa, schlief hochbetagt
am 7. November 1976 im tiefen Frieden ein.
Sie hatte die höchsten Sprosse der
Himmelsleiter erreicht.
|
 |
| Maria im
jugendlichen Alter – eine
Stütze der Familie |
| |
| |
 |
| Maria mit Mutter
Barbara |
|
| |
|
 16.
Mutters Tod 16.
Mutters Tod Entgegen ihrer
ansonsten so robusten Art wurde es nun
Mutter plötzlich schlecht. So etwas
kannte man von ihr nicht. Ein Arzt wurde
gerufen, der attestierte, dass eine akute
Lebensgefahr besteht. Kaum ein Jahr lebte
Mutter in großer Zufriedenheit im
schönen Haus, da wartete der Tod auf sie.
Ich wurde sofort wieder von meinem
Klosterdienst frei gestellt und pflegte
fortan Mutter. Tag und Nacht saß ich an
ihrem Bett. Mutter war sehr gefasst und
sah darin, dass ihre Kinder so gut
gediehen waren, ihre Lebensaufgabe
erfüllt. Die harte Zeit in Argentinien
hatte alle Kinder geprägt – auch
den Franz Josef, der im Leibe der Mutter
in schwerster Zeit gedieh. Sie waren
gesundheitlich zäh, waren fleißig,
konnten entbehren und achteten die Eltern.
Mutter wusste, dass sie eine intakte
Familie verließ. Sie hatte alle Hürden,
die ihr gestellt wurden, gemeistert.
Stolz und zufrieden konnte sie nunmehr
das irdischen Leben abschließen.
Im Gebet gedachten wir oft an Vater,
Lucia und Werner. Für Mutter waren sie
nun nicht mehr weit weg. Sie wusste, dass
ihr Tod nahte. Am Sonntag nach
Dreikönige sagte Mutter: „Maria,
geh’ mal hin zu Rudolf. Um diese
Zeit machen sie den Christbaum an.“
Und wirklich, die ganze Familie mit den
sieben Kindern saßen um den
Weihnachtsbaum herum. Sie beteten und
sangen Weihnachtslieder. Es war ein Bild
voller Harmonie und Wärme. Als ich ganz
beeindruckt zur Mutter zurückkam und ihr
dies so erzählte, weinte sie vor Glück
und Freude.
Sehr erfreut war Mutter, als sie ihr
Sohn Leo mit Frau und Kind, die aus Halle
an der Saale angereist kamen, noch einmal
besuchten. Zuerst war sie mit dieser Ehe
nicht einverstanden gewesen, da das
Mädchen evangelischer Konfession war.
Doch nun erkannte sie, wie nett und
sympathisch die junge Frau war, die sogar
ihrem drei Jahre alten Töchterchen das
Beten gelehrt hatte.
Franz Josef und seine Frau Sophie
hatten Mutter ein nettes und großes
Zimmer gemütlich eingerichtet. Außer
dem Bett gab es ein schönes Sofa, einen
Tisch mit Stühlen und einen großen
Wäsche- und Kleiderschrank im Raum.
Und nun sagte Mutter plötzlich zu mir:
„Maria, sieh mal nach, in der
Kommodenschublade liegt mein Leichenkleid.
Schon vor einigen Jahren habe ich es mir
machen lassen – mit Haube und
verziert mit schönen Spitzen.“ Ich
holte das Verwahrte herbei und wir beide
bewunderten die schöne Machart. Es war
sehr beruhigend, wie Mutter ihrem nahen
Tod entgegen sah. Sie war eine Heldin -
wie sie es auch in ihrem ganzen Leben war.
Mutter war auch glücklich gewesen zu
wissen, dass sie ihre letzte Ruhestätte
auf dem Petersberg fand. Eine solche
irgendwo in der argentinischen Wildnis zu
haben, war für sie ein Albtraum.
Mehrmals bekam Mutter die
Sterbesakramente. Mit Pfarrer Acker
sprach sie dann recht offen und
realistisch über den baldigen Tod, vor
dem sie keine Angst hatte.
Ruhig, ja sachlich interessiert für
alles was vorkam, blieb Mutter auch in
der letzten Woche ihres Lebens. Sie
stellte keine Ansprüche - war ein
frommer und bescheidener Patient.
Bescheidenheit zeichnete sie auch im
Leben aus. Auch als sie es zu einem
bürgerlichen Wohlstand gebracht hatte,
behielt sie diese Charaktereigenschaft.
Sie hielt nichts von den Pharisäern, die
nach Außen hin bei jeder Gelegenheit,
die sich nur bot, ihre Frömmigkeit und
auch ihren Reichtum zur Schau stellten.
Sollten sie doch eher durch Taten ihren
christlichen Glauben unter Beweis stellen.
Es war am Fastnacht-Nachmittag, zwei
Tage vor ihrem Tod, da sagte sie zu mir:
„Ich höre, dass der Fastnachtszug
durchs Dorf geht. Schaue ihn dir einmal
an.“ Dies tat ich und freute mich,
Mutter erzählen zu können, dass ich
Rudolfs Kinder sah und wie musikalisch
sie sich gegeben hätten. Aloys wirkte
mit einer Geige mit, und auch Werner
spielte ein Instrument, während Maria
zur Musik den Takt geschlagen hätte.
Mutter war zu Tränen gerührt und
glücklich.
Am folgenden Dienstag wurde Mutter
immer schwächer. Rudolf wollte die Nacht
mit mir abwechselnd bei ihr wachen.
Mutter meinte jedoch, dass es gut wäre,
wenn er zu Hause in seiner Bäckerei
wäre, wo er doch benötigt würde, um
den Leuten das Brot zu backen.
„Maria ist ja da und Josef mit
seiner Frau Sophie steht ja auch bereit.“
Sie schliefen nebenan im Zimmer.
Nach Mitternacht sagte Mutter:
„Maria, komm und nehme meine Hand.“
Ich betete mit ihr. Nach ein Uhr sagte
sie: „Maria, ich sterbe!“. Wie
erschrocken kamen ihre Worte. Darauf
sagte ich: „Mutter, bist du auch
ergeben in Gottes heiligem Willen?“
Worauf Mutter dreimal „JA“
sagte. Ich rief Josef und Sophie, die
sofort kamen. Mutter hatte sich
inzwischen auf eine Seite gelegt und
schlief ein – für immer. Da alles
so schnell ging, trafen Rudolf und seine
Familie ein, als ihr Geist schon im
Jenseits war. An ihren Gesichtszügen
konnte man deutlich erkennen, dass sie
mit großer Zufriedenheit eingeschlafen
war.
Ich zog nun Mutter das schöne Tüll-
und Spitzengewand an. Sie lag da so
majestätisch, als ob sie sagen wollte:
„Jetzt, nach durchrungenem schweren
Kampf habe ich die Krone der
Gerechtigkeit empfangen; denn der Kampf
ist jetzt mein Glück!“ Es schloss
sich ein Lebenskreis, der von
christlichen Grundsätzen geprägt war:
Glaube und vertraue auf
Gott!
Der Glaube gibt Kraft und Zuversicht.
Gott zeigt dir den Platz, wohin du
gehörst.
Wenn du verzweifelst in größter Not
und dringend auf Gottes Hilfe wartest,
habe Geduld.
Nach jeder dunklen Nacht folgt ein heller
Morgen.
Hürden, die gestellt werden, sind eine
Herausforderung.
Sie zu bewältigen, ist Gottes Wille
und machen den Sinn des Lebens aus.
Nicht derjenige, der nach Außen hin
zeigt, wie christlich er sei, erntet
Gottes Wohlgefallen,
- jedoch der, der es in bescheidener Art
durch Taten beweist.
Die einfachsten Menschen
sind oft die ehrlichsten Menschen
und haben die klarsten Gedanken.
Bete, und du wirst empfangen.
Doch Gottes Wege sind oft unergründlich
und lassen nicht selten lange auf Antwort
warten.
Und dass es Gott gibt,
das erkennen wir an der Natur
und an der Mächtigkeit des All’s.
Der Tod gehört zum Leben.
Jede Blume wird einmal welken
- auch die Allerschönste.
|
 |
| Franz Josef mit
Ehefrau Sophie |
| |
| |
 |
| Leo mit Ehefrau
Olga |
| |
| |
 |
| Rudolf... |
| |
| |
 |
| ...und seine
Ehefrau Elisabeth |
| |
| |
 |
| Der letzte Gang
führte über den sogenannten
Totenweg hinauf zum Petersberg |
| |
| |
 |
| Der Neefer
Friedhof auf dem Petersberg zu
jener Zeit – seit Urzeiten
die letzte Ruhestätte der Neefer
Bürger |
|
| |
|
 17. Ahnentafel 17. Ahnentafel 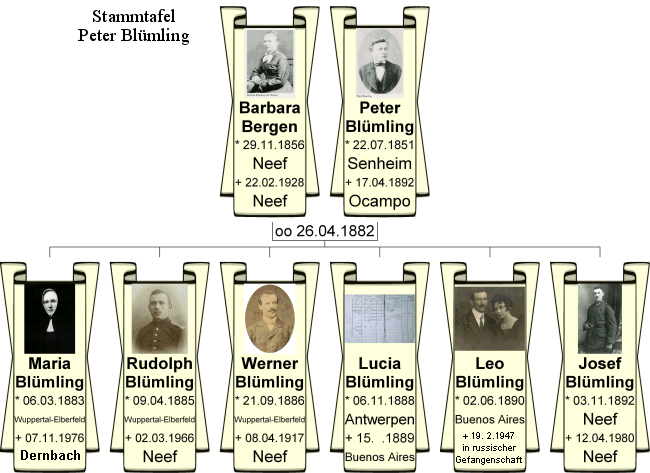
|
| Literaturnachweise: |
| |
Tagebuch von
Peter Blümling
Aufzeichnung der Ehrwürdigen
Schwester Verenosa |
| Bildnachweise: |
| |
Fotos und
Patentschriften - Im Besitz des
Autoren
Auswanderungsschiff -
Norddeutscher Lloyd, Geschichte
einer bremischen Reederei
Deutsches
Auswandererhaus, Bremerhaven |
|
|